Bild-Verwandtschaften
Über G.R.A.M.
 Als 1979 in der Münchner Städtischen Galerie im Lenbachhaus Selten gehörte Musik[1] aufgeführt wurde, standen die Bewahrer tradierter Werte kopf. Und das, obwohl dieses Happening zu dieser Zeit längst Rückblick auf ein Stück Kulturgeschichte war, mit der die Wiener Aktionisten seit 1968 mächtig aufgeräumt, ihr alle erdenklichen Zöpfe abgeschnitten, ihr den Muff aus tausend Jahren aus den Talaren geblasen hatten. Es war zu dieser Zeit eher ein vergnügliches Aufgießen, das die aktionistischen Recken in der ehemaligen Villa des Malerfürsten Franz von Lenbach veranstalteten; jedenfalls im Vergleich zu dem, was die Urväter der österreichischen Kunstrevoluzzerei zwanzig Jahre zuvor geboten hatten. Auch schmunzelte in der Aula des Lenbachhauses ein längst postmodern orientiertes, geradezu universitär wissendes Auditorium, während auf der Bühne Dieter Roth Paul Renner mittels Gartenschere die Haare bis auf die Kopfhaut blutig schnitt.
Als 1979 in der Münchner Städtischen Galerie im Lenbachhaus Selten gehörte Musik[1] aufgeführt wurde, standen die Bewahrer tradierter Werte kopf. Und das, obwohl dieses Happening zu dieser Zeit längst Rückblick auf ein Stück Kulturgeschichte war, mit der die Wiener Aktionisten seit 1968 mächtig aufgeräumt, ihr alle erdenklichen Zöpfe abgeschnitten, ihr den Muff aus tausend Jahren aus den Talaren geblasen hatten. Es war zu dieser Zeit eher ein vergnügliches Aufgießen, das die aktionistischen Recken in der ehemaligen Villa des Malerfürsten Franz von Lenbach veranstalteten; jedenfalls im Vergleich zu dem, was die Urväter der österreichischen Kunstrevoluzzerei zwanzig Jahre zuvor geboten hatten. Auch schmunzelte in der Aula des Lenbachhauses ein längst postmodern orientiertes, geradezu universitär wissendes Auditorium, während auf der Bühne Dieter Roth Paul Renner mittels Gartenschere die Haare bis auf die Kopfhaut blutig schnitt.Anfang der sechziger Jahre nahm das Publikum teil an den ersten «poetischen demonstrationen», den «literarischen cabarets». «Spaß macht so richtig Spaß nur», erinnert Helmut Salzinger[2], «solange die anderen sich darüber ärgern. Unverständnis, Widerspruch. Ablehnung, empörter Protest sind ein ergiebiger Quell der Inspiration für den, der es darauf angelegt hat, durch sein Tun die Umwelt in ihrer Ruhe zu stören.» Kabarettistisch an diesen Veranstaltungen waren, so Salzinger, allerdings «bestenfalls die eingelegten Chansons, im übrigen aber entsprachen sie überraschend genau dem, was zur gleichen Zeit in New York erfunden wurde, dem Happening. Vorgänge sollten ausgelöst werden, in denen die Wirklichkeit sich selber agiert, zugleich Subjekt und Objekt der Demonstration ist». So plante man beispielsweise, «einen Zuschauer um seine Armbanduhr zu bitten, unter dem Vorwand, sie werde für einen Varietétrick benötigt. Diese sollte dann in einen Plastikbeutel gesteckt, auf einem Amboß mit kräftigen Hammerschlägen zertrümmert und dem Eigentümer mit der Entschuldigung, der Trick habe leider nicht geklappt, zurückgegeben werden. Auf dessen Reaktion wäre es dann angekommen. Gewiß, dergleichen ist terroristisch; aber gerade das, die terroristische Willkürlichkeit realer Vorgänge und Ereignisse, galt es ja zu zeigen.»[3] Salzinger bezog sich dabei auf die mittlerweile legendäre Dokumentation Die Wiener Gruppe[4].
Zwar hatte es nach Friedrich Achleitner eine Formation unter diesem Namen nie gegeben.[5] Dennoch sollte sie unter diesem Begriff in die Kunstgeschichte eingehen, die Gruppierung aus Wien. Doch wie sich das mit Gruppen nunmal so verhält, in der Hoch-Zeit der Formationsbildungen allemale: Es gab Groupies, Freunde, Anhänger, auch Trittbrettfahrer. Und die entwickelten, durchaus typisch wienerisch, eine gewisse Eigendynamik. Das belegen Gespräche[6] im Umfeld von Uzzi Förster, einem bekannten Jazzmusiker und Kneipenwirt, der regelmäßig in der nicht minder legendären Wiener Bar Strohkoffer[7] auftrat und dort auch gut und gerne Gast war[8]; wie nahezu alles aus dieser kulturrevolutionären Metropole, das später in die kunsthistorischen Annalen eingehen sollte. Da soll im Vorfeld der Kabarett-Darbietungen ein Reporter in den Katakomben der österreichischen Hauptstadt wegen seiner «Lügen», die er in der Illustrierten Stern verbreitet habe, vor einem «Volksgerichtshof» zum Tode auf dem Blutgerüst verurteilt und auch einige Tage in einer entsprechenden Zelle gefangengehalten worden sein. Er kam wieder frei. Die Guillotine blieb ihm erspart. So libertär war die Revolution der Kunst dann doch.
Vor nichts und niemandem machte sie halt, Ehrfurcht vor Tradiertem gehörte in den Fäkalbereich, Ironie war das Gelindeste, was der Vergangenheit passieren konnte. Doch nun befindet sich diese Vergangenheit im Museum. Dort wird sie neu ausgeleuchtet, und zwar von Künstlern beziehungsweise mit deren Mitteln einer neuen medialen Wirklichkeit. Das geschieht nicht ohne Achtung. «Der Wiener Aktionismus ist eine kunsthistorische Großtat», so G.R.A.M. Man wolle diese Leistungen auch keineswegs schmälern. Allerdings gebe «es Facetten im Aktionismus, auch Teile der Rezeption, die — vor allem in Österreich — sehr pathetisch und ‹bierernst› erscheinen. Aus diesem Grund wollten wir mit den Bildern, die vom Aktionismus geblieben sind, arbeiten. [...] Diese wollten wir nachstellen, diese wollten wir neu interpretieren. Es ging unter anderem darum, den Humor zu betonen und somit einen ohnehin schon vorhandenen Aspekt zu unterstreichen, der jedoch im allgemeinen Pathos und Skandalisierungswahn untergegangen ist. Nachstellungen, Inszenierungen sind zentraler Bestandteil des Repertoires der Grazer Gruppe G.R.A.M. Kernthema ihrer Kunst ist es, «zeitgenössische formale Ästhetik zu variieren, in einem anderen Kontext zu sehen und damit Irritationen zu schaffen».[9] Letzteres taten die Wiener seinerzeit auch, und zwar aufs heftigste. Dafür möchten sie nun, in die Jahre gekommen und Geschichte geworden, die Steirer ein wenig abstrafen. Die Revolution mag ihre Kinder fressen. Doch der Nachwuchs — das haben die Alten sie gelehrt — hat sich zu wehren.
G.R.A.M. hat, quasi im Zuge der antiautoritären Erziehung[10], die Kreativität und Selbständigkeit förderte, ihre eigenen Mittel entwickelt und nutzt sie, ohne die tradierten zu begraben. Da unterscheiden sie sich von den alten Kämpen, die nicht nur Zöpfe, sondern die dranhängenden Köpfe gerne gleich mit abschnitten. Das mag auch daran liegen, daß den Jungen ein anderes Theorierepertoire zur Verfügung steht: sie sind Magister der Kunst und deren Geschichte. Das Kalkül der Evolution nimmt ihnen vermutlich auch einiges von der bisweilen verbissenen Ernsthaftigkeit, mit der einige Wiener Aktionisten an ihrer Verbesserung der Welt, zumindest Mitteleuropas[11] bauten. «Die Protagonisten von einst», so G.R.A.M., «Hermann Nitsch und Günter Brus [im vorliegenden Fall], reagierten in Leserbriefen erbost auf die positive Berichterstattung über unserere Ausstellung.» Wiener Blut.
«Und sie laufen! Naß und nässer
Wird's im Saal und auf den Stufen:
Welch entsetzliches Gewässer!
Herr und Meister, hör' mich rufen! —
Ach, da kommt der Meister!
Herr, die Not ist groß!
Die ich rief, die Geister,
Werd ich nun nicht los.»[12]
Den beiden Altmeistern des Jahrgangs 1938 waren die rund fünfundzwanzig Jahre Jüngeren offenbar zu wenig ernsthaft bei der Sache. Ableger der Spaßgesellschaft, das war auch der Hauptvorwurf, den Martin Behr und Günther Holler-Schuster sich anhören mußten.
G.R.A.M. — Günther Holler-Schuster, Ronald Walter, Armin Ranner, Martin Behr — wurde 1987 in Graz gegründet. Ronald Walter und Armin Ranner sind seit etwa 1997 nicht mehr mit dabei, da sie sich beruflich anders orientiert haben. Der Gruppenname wird jedoch weiterhin konsequent beibehalten.
Die Mißtöne dürften in erster Linie einer eher oberflächlicheren Rezeption der Unschuldigen Anarchisten geschuldet sein. Und das, obwohl bereits der Titel auf einen eher analysierenden Kontext dieses scheinbaren Kinoklamauks verweist. «Der masochistische Humor von Laurel & Hardy», betitelt der Filmwissenschaftler Drehli Robnik seinen Aufsatz zu dieser Bilderserie von G.R.A.M. und bezieht sich auf die Galionsfigur der strukturalistischen Semiotik, einem frühen Analytiker gesellschaftlicher Phänomene und deren miteinander verwobenen Zeichen: Text, Film, Photographie, auch Werbung. «‹Ihre Dummheit rührt mich›, schrieb Roland Barthes nicht über Laurel & Hardy, sondern, wie es weiter heißt: ‹So konnte eine gewisse Definition des stumpfen Sinnes lauten.› Dieser stumpfe Sinn — ein ‹dritter Sinn›, abseits von Information und Symbolik — erschließt unserer Lektüre, sofern sie geschmäcklerisch und taktil genug mit Bildern umgeht, ‹das eigentlich Filmische›: eine ‹Signifikanz› des im Film Sichtbaren, die sich gerade nicht ‹am rechten Ort, in der Bewegung, in natura abzeichnet›.»[13]
Die Hochzeit der beiden als Filmanarchos nicht so recht Erkannten ist zugleich die Blütezeit von Performance, Happening und Fluxus der fünfziger und sechziger Jahre.[14] Das an diesen Kunstdisziplinen weniger interessierte Publikum hat zu dieser Zeit seinen Spaß noch im programmfreien Kino. In den Achtzigern schaffen es die beiden gerngesehenen Tolpatsche dann schon auf die Bühne. Urs Widmer formuliert sie um zu (deutschen) Theaterfiguren: Stan und Ollie in Deutschland.[15] Einige Jahre später firmieren Laurel & Hardy — vor allem wohl über das auch wirtschaftlich expandierende Privatfernsehen — dann unter «Kult». Analysten und Analytiker haben gleichermaßen gut zu tun mit diesem Phänomen. Die theoretische Rezeption ist dem Spaßfaktor allerdings trotzdem unterlegen.
Behr und Holler-Schuster fahren einen zweigleisigen Weg der Wahrnehmungsvermittlung. Sie machen sich ihre Medienkenntnisse zunutze und bringen sowohl den reinen Unterhaltungstrieb als auch die Auseinandersetzungsbereitschaft ins Spiel. «Die Bilder sind je nach inhaltlichem Background, den man hat, verschieden lesbar. Wenn man solche Dinge wie in den Sechzigerjahren aufführt, dann bekommen die so etwas Tanztheater-Slapstickartiges», beschreibt Holler-Schuster den G.R.A.M.-Ansatz.
«Wir gehen davon aus, daß das Performancekunst ist», ergänzt Behr und fügt hinzu: «Die alte Gleichung Kunst ist Leben, Leben ist Kunst ist hier auf ironische Art erfüllt.»[16]
Wem käme bei dieser Formulierung nicht das Diktum der Romantiker in den Sinn: L'art pour l'art.[17] G.R.A.M. verneinen diesen Denkansatz jedoch. «Wenn man von einer Forderung wie dieser ausgeht, so ist der Mißerfolg miteinberechnet — zumindest hat es aus der historischen Distanz den Anschein. Diese Forderung haben wir nicht romantisch gemeint, sondern bezogen auf die avantgardistischen Bestrebungen der 1960er Jahre. Diese Gedanken hatten ja sehr weit bis in unsere Zeit hinein Bedeutung. Außerdem ist das ein so starkes Ansinnen, wie die Forderung von Joseph Beuys, wonach jeder Mensch ein Künstler sei. Gut, das kann man verkürzen, falsch verstehen und mißbräuchlich verwenden. Alles das nehmen wir uns sehr bewußt heraus, weil wir ja nicht dazu da sind, alte Forderungen zu erfüllen. Und wenn das doch der Fall sein sollte, dann nur in einem sehr wörtlichen Sinn. Man muß wohl radikale Äußerungen aus der Vergangenheit von Zeit zu Zeit neu befragen …»
Zwar waren es gerade die (theoretisch gefestigteren) Romantiker, die den Mißerfolg insofern in ihrem Programm hatten, als sie bewußt keines verfolgten und es für sie — quasi (non-)programmatisch — auch nicht von Belang war. Obendrein hat (der ausgewiesene Romantiker) Joseph Beuys nie gesagt, jeder Mensch sei ein Künstler.[18] Dennoch kann auch eine dezidiertere, nicht dem landläufigen Verständnis unterworfene romantische Haltung den beiden nicht unbedingt unterstellt werden. Die Blaue Blume[19] der Sehnsucht ist ihnen zu weit entfernt von heutiger Deutung. Sie ist zu «sehr abgegriffen, viel zu klischeehaft, als daß wir damit zu tun haben wollten». Dennoch könnten die ironischen Phantasien eines E. T. A. Hoffmann oder eines Jean Paul durchaus greifen in ihrem medienanalytischen Schwarz-Weiß-Theater.
Sie befinden sich eben weitab vom unvollendeten Projekt Moderne. Ihr Ressort ist eine nachmoderne Betrachtung, nach der systematisch «radikale Äußerungen aus der Vergangenheit von Zeit zu Zeit neu» befragt werden. Die Perspektiven, das Rezeptionsverhalten haben sich alleine über die neuen Medien derart verändert, daß einem Publikum mit althergebrachter Betrachtungsweise nur äußerst schwierig beizukommen ist. Die G.R.A.M.-Künstler bieten keine Kunst für Kunsthistoriker, kein Minderheitenprogramm. Die Mehrheit lebt heute zudem zunehmend von und mit dem Bild. Auch wenn der aufgeklärte Minorit bisweilen ahnungsvoll auf diese Massenbewegung starrt, die da kerzengerade in Richtung einer neuen biblia pauperum[20] unterwegs zu sein scheint: Die Zeitgeister haben noch nie Rücksicht genommen. Und es findet nunmal eine mediale Erdachsenverschiebung statt, bei der sogar die Astrologen den Rechenschieber werden betätigen müssen.
Die G.R.A.M.-Künstler füttern im Dschungelcamp aktuellen Kunst(medien)verständnisses das Bedürfnis nach Wiedererkennbarem. Sie liefern scheinbar schlichte Rezepte der Bildvermittlung. Doch sie tun es dialektisch raffiniert, indem sie zwar die altbekannten Bilder bieten, ihnen aber methodisch Gegensetzlichkeit und Widersprüchlichkeit untermischen, die durch unterschiedliche Blickwinkel entstehen.
«Ist es ein Hochzeitsphoto von Homosexuellen oder das Photo einer Erstkommunion von viel zu alten Männern, ein Diktatorenphoto oder das Photo einer Reisegruppe?» (siehe obiges Titelblatt) so Günther Holler-Schuster. «Dasselbe Bild kann von verschiedenen Personen völlig unterschiedlich wahrgenommen werden», ergänzt Martin Behr.[21] G.R.A.M. spielt mit den Inhalten, wie wir sie aus der sogenannten Wirklichkeit kennen, mit denen wir via Fernsehen oder Internet alltäglich vollgestopft werden und dabei kaum mehr den Unterschied sehen zwischen Urgroßmutters handgesticktem frommen Bildchen überm Herd und der computergenerierten Photographie aus der weltweiten Bildfabrik. «Für die Gruppe liegen dem, wie sich der nordkoreanische Diktator präsentiert, und dem, wie sich die Bosse multinationaler Konzerne gebärden, dieselben Mechanismen zugrunde.»[22] Es sind dieselbem Pathosformeln, nach denen wir untergerührt werden in diesen Einheitsbrei.
Kim Jong Il steht inmitten blühender Landschaften, verkündet seinen geliebten Mitbürgerinnen und Mitbürgern prosperierende Träume. Das ist das Bild, das uns vom nordkoreanischen Führer von einschlägigen Publikationen her entgegenleuchtet. Es ist eine uns vertraute Choreographie des Stillgestandens. Realität aus bunten Blättern und Bildern. Doch Wirklichkeit? «Schaut man genauer hin», stellt Franz Niegenhell fest, «so wird ersichtlich, daß nichts davon wahr ist. Aufgenommen wurde das Bild westlich von Graz, am Plabutsch. Dort wurden einige der spärlichen, in den Westen freigegebenen Selbstdarstellungen des ‹geliebten Leiters› von der Künstlergruppe G.R.A.M. nachgestellt.»[23]
Doch nicht nur am Plabutsch[24] verändern G.R.A.M. die Perspektiven der Wirklichkeiten. Auch ist Lenin nicht von Martin Behr aufgebahrt im Moskauer Mausoleum abgelichtet worden. Hier liegt der Künstler selbst, ein grotesk anmutender Rollentausch. Und in diesem Spiel posiert Behr auch als sein verschiedener Landsmann aus dem oberösterreichischen Braunau, der sich so gerne als Weltenherrscher präsentierte oder hält als Günter Brus den Kopf hin für den Rückblick in den Wiener Aktionismus beziehungsweise seinen Allerwertesten, um Holler-Schuster ein Ei auf die jüngere Kunstgeschichte schlagen zu lassen.
G.R.A.M. stellen nicht nur nach, sie persiflieren auch, was und wem sie nachstellen. So sind Stan und Laurel nicht Stan und Laurel, sondern Holler-Schuster und Martin Behr im betulichen Stadtgärtchen mit der vermeintlichen Ikone des Kleinbürgers; einmal mehr wird hierbei die Darstellung des Komischen in schlichtere Komik überführt. Doch die satirische Komponente in den Photographien, in denen die beiden sich einreihen als Global Player oder VW-Vorstände, dürfte den einen oder anderen weniger Informierten bereits überfordern, ihn in eine kaum mehr unterscheidbare mediale Wirklichkeit überführen. Ob er die der Ironie innewohnende bittere Wahrheit erkennt, bleibt dahingestellt.
Die Satire sei angesichts der Ereignisse nicht in der Lage, die Realität einzuholen, stellte der nahe der österreichischen Grenze großgewordene Kabarettist Siegfried Zimmerschied Mitte der siebziger Jahre fest. Und um einige Jahre zuvor war es der G.R.A.M.-Landsmann Helmut Qualtinger, der mit seinem Herrn Karl die Biederkeit in ein Schreckensbildnis umkehrte.
Schrecken wohnt auch der Nachstellung der berühmten Szene von 1972 des einzelnen Terroristen auf dem Balkon im Münchner Olympiagelände[25] inne, allerdings wohl in erster Linie für diejenigen, die sich der Geschehnisse erinnern. Wohl nur für sie erfährt dieses Sujet eine Wendung in das Bedrückende, die das Bild-Kabarett aufarbeitet. Denn der Wiedererkennungswert für Jüngere dürfte bereits im Entstehungsjahr 2001 nicht ganz unproblematisch gewesen sein. Bei der nachgebildeten, um die Welt gegangenen Photographie der Erschießung eines vietnamesischen Soldaten durch einen US-amerikanischen ist im Gesicht von Günther Holler-Schuster die Ernsthaftigkeit des Geschehens auch nicht so recht erkennbar. Daß es nach dieser Inszenierung in der Grazer Peripherie dennoch zu einer lebhaften Diskussion kam, ist aufgrund der aktuellen Ereignisse allerdings verständlich.
Überhaupt stellt sich die Frage, ob der ständig mit Schreckensbildern aus den Kriegsregionen Versorgte sich ohnehin vielleicht gar nicht mehr in der Lage sieht, anders zu reagieren als mit einem Überdruß, der sich, wenn überhaupt, zynisch äußert. Er hat ohnehin Hochkonjunktur. Vielen gelten Scherz, Satire und Ironie längst als zu altbackene Kommentatoren der Wirklichkeiten. Es muß schon eine Nummer härter klingen, um die Message überhaupt untergebracht zu kriegen. Dann spielt der (heutige) Unterschied zwischen moralverletzendem Zynismus und bedeutungsumkehrendem Sarkasmus auch weiter keine Rolle mehr. Im tagtäglichen mehr oder minder witzelnden Video- und Podcastlärm muß die Botschaft immer noch ein bißchen schriller kreischen, um überhaupt vernommen zu werden. Längst beteiligen sich die öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten an diesem bunten Krach. Das wäre ja noch einzusehen, da man sich bei ARD, DRS, ORF bis ZDF (um nur die deutschsprachigen Sender zu erwähnen) auch oder vor allem dem bildergrellen Boulevard verpflichtet sieht, um die endgültige Abwanderung des Fern- oder Zusehers nach Privat-TV zu verhindern. In diesem Zug sieht sich mittlerweile manch ein kluger Zeitungskopf gezwungen, sich vor die Kamera im heimischen Computer zu setzen und seine entwicklungskritischen Lockendrehereien[26] in laufenden Bildchen zu präsentieren. Das Schreiben von Essays oder gar ganzen Büchern scheint bald noch als schmuckes Beiwerk zum journalistischen Alltag (zwischen Public Relation und Werbung) betrieben zu werden. Denn die den klugen Köpfen vorstehenden Chief Executive Officers verordnen ihrem Blätterwald zunehmend und ständig wiederholend aus den immerselben Quellen sehr bunte Bilder, in ihren Online-Ausgaben selbstredend aufgeforstet mit bewegten von Prominenten aus Kunst, Politik und Wirtschaft, vor allem der Celibritäten. Ob das alles wahrnehmungstechnisch überhaupt noch reflektiert wird?
G.R.A.M. bemüht sich, unsere desolaten Wahrnehmungsapparaturen neu zu justieren. Dabei ist grundsätzlich alles Visuelle geeignet, ins (neue) Bild gesetzt zu werden. Gleichwohl: «Die Massenmedien sind ein erster Filter. [...] Insbesondere bei der Serie Nach Motiven von, den nachgestellten Photographien von denkwürdigen Ereignissen aus unterschiedlichsten Bereichen, geht es um die massenmediale Rezeption von außergewöhnlichen Vorgängen, Happenings, Kunstaktionen, Attentaten und noch einiges mehr. Die Fixierung und Fokussierung eines Ereignisses auf ein immer wieder abgedrucktes Bild ist es, was uns interessiert.» Dieses künstlerische mediale Repetitorium ruft Neuinterpretation hervor. «Zeitgenössische formale Ästhetik zu variieren, in einen anderen Kontext zu sehen und damit Irritationen zu schaffen, ist ein Kernthema unserer Kunst.»
1997 haben Behr und Holler-Schuster während eines Stipendienaufenthaltes in Los Angeles sowohl Prominente als auch (auch ihnen unbekannte) Nachbarn täglich mit Hilfe des Teleobjektivs abgelichtet. Über dieses Einfangen von Alltag — für den Bereich bekannterer Menschen Paparazzi-Photographie genannt — entsteht trotz der banalen Abläufe ein vom eigentlichen Vorgang losgelöstes Hirnkino. «Die Gedanken kreisen rund um heimliche Liebschaften, mögliche Verbrechen oder Drogendeals. Ein interessanter Vorgang: die veränderte Bildästhetik schafft ein von den tatsächlichen Vorgängen im Bild abgehobenes, imaginäres Szenario.»
G.R.A.M. nutzen auch fremdes (Bild-)Material. Dabei begeben sie sich allerdings mitten hinein in einen anschwellenden Diskussionsgesang. «Man eignet sich diese Inhalte an und gibt sie wieder — das erinnert an sprachliche Prozesse. Das Plagiat spielt für uns keine Rolle. Es sollte überhaupt keine geschützten Bilder geben, das ist lächerlich und nicht mehr zeitgemäß. [...] Im Moment der Fertigstellung ist es für uns eigenes Material, egal, ob wir das Bild selbst aufgenommen, von einem Freund zur Verfügung gestellt bekommen oder aus dem Internet besorgt haben. Sollte es einen historischen Moment geben, in dem sich ein anderer an die Sache heran macht, ist es wohl auch sein Material. Wir haben da keine Angst und somit auch kein Bedürfnis, Territorien zu sichern.»
Auch arbeiten Behr und Holler-Schuster nicht immer alleine. Das meint nicht nur die Integration von Laiendarstellern in ihre Bildinszenierungen. Die G.R.A.M.-Artisten haben von Beginn an fröhliche Mitturner gehabt in ihrem Konzept-Trapez. Wobei das Adjektiv fröhlich zwar belustigend klingen mag, wie man bei oberflächlicher Betrachtung von Hermes Phettberg annehmen möchte, aber der Ernsthaftigkeit nicht entbehrt. Da mögen 1994 einige Schenkel geklopft oder Kopf geschüttelt haben, als der sich, wie das Magazin Falter notiert, «am Autobahnstumpf Graz-West [...], damals einem Park-and-ride-Gelände, [...] in einem öffentlichen Pissoir zum Anuriniertwerden verfügbar machte».[27] Die nicht nur körperlich schwergewichtige Figur Phettberg setzt seit Mitte der achtziger Jahre diesen eigenartigen (Wiener) Aktionismus scheinbar antiintellektuell fort, dessen künstlerische Gegenwehr in einem fundamentalen Religionismus wurzelt. Phettberg nahm darin eine schonungslose Ausstellung des Privaten vorweg, wie sie zwanzig Jahre danach, sowohl im Privatfernsehen als auch im artverwandten Bereich Internet, längst alltäglich geworden ist. So war diese wahrnehmungsanalytische Zusammenarbeit mit G.R.A.M. nicht nur naheliegend, sondern ebenso vorausschauend.
Bei allem Mut zur Lücke: Hingewiesen werden muß auf den gemeinsam mit dem Schriftsteller Gerhard Roth absolvierten Jagdausflug im Stillen Ozean.[28] Roth (be-)schreibt nicht nur, er stellt auch photographisch Bilder her. Für seinen 1980 erschienenen Roman Der stille Ozean hat er Jagdszenen aus der stillen Südsteiermark abgelichtet, einer nahe der slowenischen Grenze gelegenen Region, in der mehr noch über alles mögliche besser geschwiegen wird als anderswo. Roth «fand den Schrecken und die Idylle», schreibt Anton Thuswaldner, «eng beieinander, er lebte in der Gegenwart und stieß sich ab in die Vergangenheit, jenes große, unausgeschöpfte Reservoir, in dem sich Geschichten und Schicksale sammeln. [...] Kein Laut dringt aus der Tiefe Österreichs, und wo es so unheimlich ruhig ist, ist die Totenstille des Totschweigens über das Land gebreitet.» Photographien bilden Roths Grundlage seiner Literatur. Sie sind nach Thuswaldner Vorlage und Sprungbrett in eine neue Wirklichkeit. Dieser Wirklichkeit sind Behr und Holler-Schuster viele Jahre danach nachgegangen. «Sie imitieren Roth, und jedes ihrer Originale ist eine Fälschung. Aber was besagt das schon in einer Welt, in der Abbilder für Wirklichkeit genommen werden. Und während die Methode von Gerhard Roth von anderen aufgegriffen wird, begibt sich der Schriftsteller auf die Pirsch und photographiert die Künstler bei ihrer Arbeit.
Die Wirklichkeit ist ein großes Verwirrspiel, und mittendrin befinden sich die Männer von G.R.A.M. und erfreuen sich an der vorsätzlichen Verkünstlichung der Welt. Mit G.R.A.M. wird die Wirklichkeit zum großen Plagiat, und wir alle sind Mitspieler.»[29]
Anmerkungen
1 Attersee, Cibulka, Hossmann, Gerhard Mayer, Hermann Nitsch, Renner, Dieter Roth, Gerhard Rühm, Schwarz, Thomkins, Oswald Wiener. Selten gehörte Musik: Abschöpfungssymphonie. Februar 1979, Städtische Galerie im Lenbachhaus München
2 Jonas Überohr «Helmut Salzinger war der Diedrich Diederichsen der siebziger Jahre.» Genauer: «Diedrich Diederichsen ist der Salzinger der Achtziger und Neunziger.» Jungle World 49, 7. Dezember 2005
3 Helmut Salzinger: Provokation macht Spaß. Die Zeit, 1968
4 Die Wiener Gruppe: Achleitner, Artmann, Bayer, Rühm, Wiener – Texte, Gemeinschaftsarbeiten, herausgegeben und mit einem Vorwort von Gerhard Rühm; Reinbek 1967
5 Achleitner: «Rühm und ich haben nämlich eine Kabarettaufführung in der Schweiz vorgehabt, und da sagte man uns, wir könnten nur auftreten, wenn wir einen Namen haben. Da dachten wir also nach, und da es ‹Wiener Schule› und ‹Wiener Kreis› schon gab und überdies in einer Zeitung von einer ‹Wiener Dichtergruppe› zu lesen war, nannten wir uns ‹Wiener Gruppe›. Oswald Wiener meinte dann, da H. C. [Artmann] uns alle inspirierte, gehöre er eigentlich auch dazu, und so kam es zu dieser Bezeichnung. Die Aufführung fand dann übrigens gar nicht statt [...].» Interview mit Friederike Mayröcker und Friedrich Achleitner im Café Prückel, Wien, 6. April 1995, in: Literaturlandschaft Österreich
6 Erinnerungen des Autors
7 Siehe auch: Maria Fialik, Strohkoffer-Gespräche. Wien 1998; dem Autor ist nicht bekannt, inwieweit darin die hier erwähnten Eskapaden enthalten sind.
8 Uzzi Förster wurde für seine kulturellen Leistungen 1992 gar mit dem Silbernen Ehrenzeichen der Stadt Wien beehrt ...
9 Soweit nicht gesondert gekennzeichnet, entstammen die Zitate einem eMail-Interview vom 10. März 2008.
10 Die hat im Gegensatz zur kolportierten Meinung nichts mit laissez-faire oder gar laisser-aller (Machen-Lassen beziehungsweise Sich-gehen-Lassen) zu tun. Das sind Begriffe aus dem Wirtschaftsliberalismus des 18. Jahrhunderts, die dort ausgeliehen und ein wenig mißverständlich benutzt wurden.
11 Damit ist keineswegs eine ideologische Thesensammlung gemeint, auch wenn das häufig (in Unkenntnis) so vermittelt wird, sondern die verbesserung von mitteleuropa, der hermetische «roman» von Oswald Wiener, der zumindest dem Umfeld der (aber nicht nach ihm benannten) Gruppe zugerechnet werden muß. Das klingt «wie ein Symposium-Titel der 90er Jahre, ist aber tatsächlich ein Buch aus den 60ern, das, wie wenig andere, die österreichische und damit auch die gesamte deutschsprachige Literaturszene beeinflußt hat. Die ersten Texte von Handke, Jelinek, aber auch von Frischmuth, Gerhard Roth, Helmut Eisendle, Scharang sind ohne Oswald Wieners ›Roman‹ nicht denkbar.» Günter Brus und (hier zitiert) Sigrid Schmid-Bortenschlager, in: Oswald Wiener. Eine schonungslose Massage überkommener Botschaften.
Vor der Schreibkrise war die Denkkrise
12 Johann Wolfgang von Goethe: Der Zauberlehrling. Zitiert nach: Werke. Kommentare und Register. Hamburger Ausgabe in 14 Bänden, Bd. 1, Gedichte und Epen 1, München 1976, , S. 276 – 279
13 Drehli Robnik: Nach- und sich blöd stellem. Der masochistische Humor von Laurel & Hardy, Theo Lingen und G.R.A.M. Katalog zu Unschuldige Anarchisten, Galerie rumford 26, München; Galerie und Edition & Artelier, Graz; Patricia Faure Gallery, Santa Monica,/California, deutsch und englisch, Wien 2000, o. S.
14 «Diese neuen Kunstformen wollten mit theaterähnlichen Inszenierungen die Grenzen zwischen Künstler und Zuschauer und die Trennung von Kunst und Leben auflösen. Der Zuschauer sollte die Möglichkeit zur Teilnahme haben. Die Fluxus-Bewegung wurde von dem Amerikaner George Maciunas 1962 in Wiesbaden gegründet und war eine Form der Aktionskunst, deren Veranstaltungen meist musikalischen Charakter hatten. Tanz, Theater, Objektdarstellung, Poesie, Malerei und Musik wurden in diesen Veranstaltungen in Aktionen (Happenings) verbunden. Es erfolgte eine Abgrenzung zur traditionellen Kunst. An der Entwicklung dieser Aktionskunst arbeiteten vor allem Joseph Beuys, Wolf Vostell und Daniel Spoerri intensiv mit.» Happening und Fluxus. Aktionskunst in Österreich
15 Widmer verfaßte es für das Münchner Theater am Sozialamt, und es wurde im Anschluß auch an größeren Bühnen aufgeführt. Die Begleiterscheinung war ein allerdings ein «neues Publikum». Anette Spola, Leiterin des kleinen Theaters klagte: Sie sei zwar «sehr erfreut über das auf Monate hinaus ausverkaufte Stück. Aber das Stammpublikum bleibt draußen.» Detlef Bluemler, in: Saarbrücker Zeitung Nr. 86, 12./13. April 1980, Feuilleton, Seite I
16 Nordkorea am Plabutsch. Falter 25/2006, 21.6.2006
17 Ein von Théophile Gautier geprägter Begriff; er kann aber auch von Victor Cousin stammen. Er beschreibt eine Kunst, die sich selbst genügt und frei von Moral und gesellschaftlicher Verantwortung ist; bei den Bohèmien bezeichnet er auch die Befreiung von den institutionellen Kunstauftraggebern
18 Beuys sagte in einer kritisch-ironischen Anmerkung zu einem seiner Studenten in der Düsseldorfer Kunstakademie: Jeder sei ein Künstler, nur er sei eben keiner. Ein halber Satz also nur, aber damit eine ganz andere Wahrheit – die seither auf Postkarten durch die Welt reist.
19 Sie steht in der Romantik als Metapher für die Unendlichkeit; Novalis setzte sie in seinem Romanfragment Heinrich von Ofterdingen ein.
20 überwiegend textfreie Armenbibel des Mittelalters
21 Franz Niegelhell: Nordkorea am Plabutsch. Die Künstlergruppe G.R.A.M. ..., in: Falter, a. a. O.
22 Niegelhell, a. a. O.
23 Niegelhell, a. a. O.
24 Ein Berg bzw. ein Naherholungsgebiet in der Steiermark.
25 gezeigt innerhalb des im Genfer Centre de la Photographie Film- und Photographieprojektes Allhamduleilah
26 Nach Karl Kraus ist das Feuilleton die Kunst, jemandem auf einer Glatze eine Locke zu drehen.
27 Niegelhell, a. a. O.
28 festgehalten in: Katalog zur Ausstellung 2004 in der Bregenzer Galerie von Lisi Hämmerle
29 Anton Thuswaldner, in: a. a. O.
Erstveröffentlichung in: Künstler — Kritisches Lexikon der Gegenwartskunst, Ausgabe 82, 2. Quartal (Juni) 2008, Heft 10; hier minimal erweitert
© Für den Text: Detlef Bluemler und Zeitverlag; für die G.R.A.M.-Abbildungen: © G.R.A.M. bzw. die jeweiligen Photographen
| Mi, 20.01.2010 | link | (8956) | 0 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Bildende Kunst |
Im Lärm der Stadt
Man sei sich nicht im klaren, so stand's geschrieben in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, ob die Ausstellung Im Lärm der Stadt einen Trend dokumentiere oder ihn erst schaffen wolle. Und Beatrix Nobis verstieg sich in der Süddeutschen Zeitung in die — wohl ironisch gemeinte — Behauptung von «einer geradezu beängstigenden Bescheidenheit der künstlerischen Mittel». — Die Unsicherheit ist symptomatisch für die Zeit der aufgeregten Suche nach dem Immer-Neuen.
Tatsächlich zeigt die Stiftung Niedersachsen in Zusammenarbeit mit dem Sprengel Museum Hannover (künstlerische Leitung: Lothar Romain), wie im vergangenen Jahr mit Bis jetzt. Plastik im Außenraum der Bundesrepublik, auf: nun die Dokumentation dessen, was sich als Ablösung der raumgreifenden, platzbeherrschenden Skulptur oder Plastik im Außenraum begreift.
Im Lärm der Stadt formuliert einen Umkehrschluß: Innerhalb der geräuschvollen großstädtischen Hektik macht sich eine stille, Nachdenklichkeit artikulierende Kunst (alles andere als) bemerkbar; diese «10 Installationen in Hannovers Innenstadt» wollen er-sehen, wollen gesucht und gefunden werden. Sie stellen, analog zum gesellschaftlichen Umdenken, eine neue Be-Sinnlichkeit dar, interpretieren den Begriff Denkmal neu: Denk-Mal.
Einer der Vorreiter dieser im öffentlichen Raum versteckten Kunst ist Norbert Radermacher (er ist der einzige der zehn ausstellenden Künstler, der 1990 in Hannovers Georgengarten mit dabei war). Offensichtlich hat ihn seine Erfahrung im Finden nicht (kunst-)alltäglicher Orte so treffsicher gemacht. Denn einmal mehr lenkt er den Blick des Betrachters um: in Hannovers Innenstadt läßt er den Betrachter im besten Wortsinn sich selbst reflektieren. Aus einem 288 mal 511 Zentimeter großen, ansonsten verschiedenen Institutionen vorbehaltenen Schau-Fenster hat er eine Reflexionsscheibe gemacht, in der sich die aus Richtung Rathaus kommenden Passanten spiegeln. Ihren Tribut fordert die Diskussion um das Auto in den Innenstädten im offensichtlich ironischen Kommentar von Monika Brandmeier: Sie schuf einem Parkplatz ein Denkmal, indem sie ihm eine Art Grabplatte auflegte und diese mit zwei zweifelsfrei zweideutig roten Lichtern (Grableuchten fürs Auto und das nahe gelegene «Rotlichtviertel»?) krönte. Das Thema Auto beschäftigt auch Andreas von Weizsäcker, indem er drei «mumifizierte» Autos aus Papiermasse unter eine «Fly over» aus Beton hängt, wobei er seinen Witz mit einem Wortspiel komplettiert: Aus Hannover wurde «Hangover» — diesen Begriff verwendet der US-Amerikaner, wenn er mehrere über den Durst getrunken hat. Verwirrung stiften Maik und Dirk Löbbert mit ihrem «Integrationsobjekt Kanalstraße». Sie konterkarieren kaum merklich die untere Betonverkleidung eines Kaufhausgebäudes durch das optische «Herausnehmen» eines Teilstückes und das Verlagern der Fließenstruktur aus der Horizontalen in die Vertikale. Ein wenig zu sehr in Richtung Sinn-Stiftung zielt die Arbeit von Thomas Rudolph. Seine überzogen demonstrativ neben einen Brunnen gestellte Abdeckung wirkt platt-idealisierend; die beabsichtigte Einbeziehung des gesamten Platzes ist nur schwer erkennbar. Gelungen ist dieser Aspekt wohl Wolfgang Robbe, dessen «Fußgängerzonenkapelle» den eiligen Konsumentenschritt zu stoppen vermag.
Unbeabsichtigte Mißbilligung durch Passanten dürfte Wilhelm Mundt mit seinen verformten Glascontainern erreicht haben: Fein säuberlich getrennt werfen sie in den grünen Grünglas und in den weißen Weißglas. Mit den optischen beziehungsweise akustischen Gewohnheiten beschäftigen sich in Hannover drei Künstler, wobei p.t.t. red (Stefan Micheel und HS Winkler) ihre Arbeit von Michelangelo kommentieren lassen: «die welt ist illusion — und die kunst die darstellung der illusion der welt.» Verwundert suchen die Wartenden im U-Bahnhof Marktballe den einfahrenden Zug, der jedoch lediglich akustisch einfährt. Und Michael Hofstetter simuliert zwei optische Durchbrüche in eine Wand, die in einer Unterführung die Fußgänger von den Autos trennt. Lediglich Ingrid Roschek arbeitet mit «konventionell»-musealer Plastik, stellt Althergebrachtes und Zeitgeist jedoch gleichermaßen auf den Kopf: Ihre mit dem Pathos spielenden Plastiken sind so auf Hannovers «Aegi» plaziert, daß man sie vor lauter Integration kaum mehr sieht.
Sollte es die vornehmste Aufgabe der Kunst sein, sichtbar, sehen zu machen, dann geschieht das in Hannover durchaus. Der Betrachter, hier der Be-Suchende, hat sich der Mühe des Ergehens zu unterziehen, will er zur Kunst gelangen. Dabei dürfte er die Plätze, die Stadträume so erfahren, wie er sie lange nicht (mehr) gesehen hat. Hier zeigt sich Kunst (fröhlich-)lehrreich und kommt in ihrer Zurücknahme ohne den [pathetischen] Zeigefinger des monumentalen Denkmals aus.
Weltkunst Nr. 23, 61. Jahrgang, 1. Dezember 1991, Seite 3713
| Di, 12.01.2010 | link | (2643) | 0 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Bildende Kunst |
Traum-Räume. Raum-Träume
Über die Arbeit von Peter Chevalier
Walter Vitt wies eindringlich darauf hin: Es würden innerhalb der Branche sogenannte Fakten leichtfertig übernommen.1 Dies, aber auch der eine oder andere getrübte Blick dürften die Gründe sein dafür, daß die Gemälde von Peter Chevalier immer wieder bei Jungen oder Neuen Wilden auftauchen2, diesem Versuch der achtziger Jahre, die französischen Fauvisten3 neu und deutsch zu beatmen. Doch auch in Chevaliers Atelier hoch oben unter den Wolken von Kreuzberg ist nirgendwo «Gewühl und Hertie» versteckt. Dennoch auf dieses Phänomen der Fehlsortierung angesprochen, lautet im August 2007 seine fast entrüstete Gegenfrage: «Mal' ich vielleicht Gefühle?!» Und, wieder ruhiger: «Ich hab noch nie Lebensgefühl gemalt.»4
Chevalier gehörte, nachdem er 1980 vom Studienort Braunschweig, nicht zuletzt auf Rat seines Lehrers Hermann Albert, nach Berlin übergesiedelt war, eben nicht zu denen, die in «dem ganzen Zirkus»5 mitturnten. Zu dieser Zeit ergab es sich, daß «unheimlich viele Maler nach Berlin [kamen], zum Beispiel vom Lüpertz aus Karlsruhe, die haben weder weitergemalt noch sonst was gemacht. Die wurden einfach von der Stadt erdrückt».6 Mit einem ehemaligen Studenten von Markus Lüpertz hatte er auch anfänglich das erste Atelier gemeinsam. Doch «der kam einfach mit der Situation nicht zurecht. Da läufst du vom Kottbusser Tor hierher, von der U-Bahn, da bist du natürlich extrem einsam. Dann sollst du noch malen, oder wie?»7
Chevalier hat sich von der damaligen Hektik, der Geschwindigkeit auf dieser Insel inmitten des politischen Malstroms8 nicht mitreißen lassen. Die durch die Wusseligkeit, manchmal auch aufgepropfte Wildheit dieser Stadt entstandene Angriffslust, verursacht sicherlich nicht zuletzt durch die (geo-)politisch bedingte Ausnahmesituation, richtete er auf sich. «Man muß eine ganz bestimmte Aggression haben, hauptsächlich gegen sich selber [...]. Wenn du die nicht hast, brauchst du erst gar nicht den Pinsel anrühren.»9 Selbst-disziplinierung war es wohl, die ihn konzentriert hat malen lassen. Aber eben keine Gefühle. «Ich will», sagte er bereits in den turbulenteren Anfangszeiten, «keine exhibitionistischen Bilder malen.»10 Gefühlspornographie auf Leinwand ist bis heute nicht seine Welt. Seine Bilder zeigen Innen-Leben.
Das heißt nun keineswegs, mit Peter Chevalier einen in sich und sein Atelier zurückgezogenen Maler vorzufinden, der sich einer romantizistischen Attitüde hingibt. Ein Romantiker ist er gleichwohl. Doch Romantik ist nunmal anderen Ursprungs, als das landläufig schlichte Bild von ihr hergibt. Jochen Gerz hat dieses langlebige Mißverständnis korrigiert: «In der Romantik kommt es zur Panne des Auftrags, eigentlich ein schöner Moment, unglaublich scharf und ohne jede Entschuldigung. Scharfgestellt wird auf die Kunst, und was da steht, nackt und alleine, das ist eben die Kunst. Die Kunst ohne Dauer, Publikum, Auftrag. [...] Das entspricht einem fast französischen Begriff des Politisierten. [...] Das allerwichtigste: daß sie eine relativ würdige, unexpressive Haltung eingehalten haben des totalen Fehlens von Anlaß zu Hoffnung. Die Romantiker waren total getrennt von ihrer Liebe, ihrer Sehnsucht, ihrem Verlangen nach Ursprung oder Zukunft, von ihrem eigenen Bewußtsein, von ihrem Programm, und ohne zu klagen und zu lamentieren und ohne sich zu verbohémisieren haben sie das ausgehalten.»11
Die Romantik ist gekennzeichnet von der Sehnsucht. Weit hinten liegt das Innen. Es zeigt sich in einer sich immer weiter hinausschiebenden Ferne. Nur wer ihr nachzugehen bereit ist, wird den Brennpunkt erkennen. Zunächst jedoch ist er verriegelt mittels der ihm eigenen Symbolik. Nur wer die Metapher geknackt hat, vermag sie auszuleuchten.
Chevaliers Malerei wird, wohl wegen Symbol und Metapher, immer wieder als französisch bezeichnet, beispielsweise bei Isabel Greschat und Peter Winter.12 Auch Chevalier selbst streift das Land immer wieder mal, allerdings meist dann, wenn es um Literatur geht. Georges Simenon erwähnt er, den er in der Schulzeit gelesen hat. Maurice Merleau-Ponty, den großen Philosophen und Phänomenologen, des Forschers der Wahrnehmung, zitiert er.13 Auf Julien Green, den letzten Amerikaner in Paris, der dort auch geboren wurde, der dort gelebt und in französischer Sprache geschrieben und wohl auch geträumt hat, kommt er zurück. Auch Francis Ponge fällt ein ins Gespräch, der 1988 gestorbene Schriftsteller, der geschrieben hat, wie andere malen.
Interessanterweise hat Chevalier mit Frankreich ansonsten nicht sonderlich viel im Sinn. Sicher, einen Studienaufanthalt Ende der achtziger Jahre in der Vendée gab es, an den er sich gerne erinnert, in Les Sables d'Olonne, einem atlantiknahen Städtchen unweit der Protestantenhochburg La Rochelle. Im Museum, einem ehemaligen romanischen Kloster, hatte er dann auch eine Ausstellung seiner Gemälde und Zeichnungen.14
Doch da ist der französische Name. Ein hugenottischer ist's. Hugenotten flüchteten (zuletzt) Ende des 17. Jahrhunderts zuhauf auch nach Deutschland, korrekt: in deutsche Länder; damals gab es das Deutschland noch nicht, das heute bekannt ist.15 So kam ein Teil von ihnen ins Badische. Und von dort stammt Peter Chevalier.
Hugenotten waren Protestanten, genauer: Calvinisten, recht rabiate Vertreter einer Offenbarungslehre, die jedweden Kult(us) ablehnten, deren Hölle die des völligen Verzichtes auf alles ist und deshalb für viele noch ärger brennt als die katholische, zumal die die Beichte kennt und den Ablaß. Ob der ins Hugenottische verbannte Peter Chevalier sich deshalb nach der katholischen Wurzel sehnt? Ist er auf dem Weg zum sehr späten Konvertiten in die Vergangenheit?
Nun sind seine Gemälde nicht eben ausgeprägt katholisch, schon gar nicht erfüllt von hymnischem Laudate. Als ob er seiner Verehrung nicht traute, versteckt er den Kultus in einem üppigen Protestantismus. Doch auch hier schimmert eine Sehnsucht durch: «Es ist faszinierend, daß es in der Kirche so viele Bilder gibt und gab — wie die katholische Kirche mit den Künstlern umgegangen ist. Das ist das Gegenteil vom Protestantismus.»
Nun darf man anderer Meinung sein über den früheren, aber durchaus auch aktuellen Umgang der katholischen Kirche mit Kunst und Künstlern. Richtig ist wohl, die Malerei gäbe es ohne Päpste beziehungsweise Kardinäle respektive Fürsten und Grafen nicht, die ebenso der Kirche ergeben waren, die ja für den unabdingbaren Glauben stand. Es gab nichts Höheres als die Kirche. Nur Gott stand darüber. Und wer, wie die Hugenotten etwa, anders geartet glaubte oder, später, der Vernunft ergeben war, befand sich im Bund mit dem Teufel und wurde auch schon mal gevierteilt oder sonstwie massakriert. Durch die Kirche, die katholische. Kirche bedeutete Allmacht. Und Kunst bedeutet(e), vereinfacht formuliert: Huldigung Gottes. So sieht das auch ein regierender Kirchenoberer des 21. Jahrhunderts.16 Das war der Kult, den die Protestanten abgeschafft wissen woll(t)en und den viele Katholiken heute vermissen. Deshalb wohl wird mancherorts die Messe wieder lateinisch gelesen.
Ist es das Mystische in diesem Umfeld, das Peter Chevalier anzieht? Das Mysterium Malerei?
Francis Ponge. Er hat zwar nicht gemalt. Aber er hat sich in seiner Dichtung, in seinen Essais den ‹Dingen›17 suchend, (be-)schreibend genähert. «Die Texte wollen den Gegenständen ähnliche Objekte aus Sprache sein [...] als eine Art Definition und Deskription alltäglicher Dinge [...].»18 Ähnlich, so ließe es sich betrachten, geht Peter Chevalier in seiner Malerei vor. Wenn seine Gegenstände auch andere sind als die des Alltags, der sogenannten Wirklichkeit.
Ponge schreibt von sich ein Bild, das eine Nähe zu Chevalier darstellen könnte: «[...] Die am besten begründeten Ansichten, die harmonischsten (bestgebauten) philosophischen Systeme sind mir immer völlig brüchig vorgekommen, haben bei mir einen gewissen Widerwillen, der unbestimmt an die Seele griff, ein peinliches Gefühl der Unbeständigkeit hervorgerufen. [...] So erscheinen mir die Ideen an und für sich als das, wozu ich am wenigsten befähigt bin, und sie interessieren mich kaum.»19 Die Dinge an sich interessierten ihn, die Welt in den Dingen, zum Beispiel in der Auster:
«Drinnen findet man eine ganze Welt, zu essen und zu trinken: unter einem Firmament (im eigentlichen Wortsinn) aus Perlmutt senken sich die Oberhimmel auf die Unterhimmel und bilden mit ihnen eine einzige Lache, einen grünlichen, klebrig-zähen Beutel, der für Geruchssinn und Auge schwillt und sinkt, am Ufersaum mit schwärzlichen Spitzen besetzt.»20
So tastet sich auch der Maler langsam an die Innenwelt der Dinge heran. Die Form an sich spielt eine Nebenrolle. Denn die ergibt sich ohnehin beziehungsweise ändert sich fortwährend während der Suche nach dem Wesen der Dinge. Von Ponge wird bisweilen behauptet, er schreibe nicht auf die Metapher hin. Auch das kann man anders sehen. Denn sie entsteht in seiner Gegenstands-Beschreibung letztendlich doch. Chevalier malt den Gegenstand des Un-Eigentlichen. Auf der Suche danach führt es ihn zu Wesentlichem, das sich in einer symbolartigen Figur ausdrückt, die einen eigen-artigen Raum benötigt. Die Schnecken von Francis Ponge drängen sich auf: «Als Heilige machen sie ihr Leben zum Kunstwerk — ihre Vervollkommnung zum Kunstwerk. Sogar ihre Sekretion geschieht derart, daß sie zur Form gerät.»21 Peter Chevalier muß sich auf diesen Mal-Spuren befinden.
Théophile Gautier. Ihm wird das mindestens so oft wie der Begriff Romantik mißbrauchte, zumindest aber mißverstandene L'art pour l'art22 zugeschrieben, einer Kunst, die sich selbst genügt und frei von Markt, Moral und gesellschaftlicher Verantwortung ist. Am deutlichsten hat sich die Kunst um der Kunst willen in der Dichtung von Charles Baudelaire gezeigt, dieser romantische Schöpfer der Antipoden der romantischen Blauen Blume, der Bösen Blumen, diesen ungeheuerlichen, die Ästhetik des sogenannt Häßlichen besingenden, selbst in deutscher Übersetzung noch sprachgewaltigen Gedichten Les Fleurs du Mal.23 Es verneint alles, was dem Verständnis, der Erkenntnis zuträglich sein könnte. Baudelaire verwendet keinerlei genaue Beschreibung, er ergeht sich in (alp-)traumartigen Verfremdungen. «Die Empfindungen», so Gert Pinkernell, «die durch diese Symbole ausgelöst werden, sollen dem Wesen der Idee entsprechen und neue Ebenen hinter der scheinbaren Realität aufdecken. Den Symbolisten [...] gelang es mit Hilfe ihrer fließenden Sprache Effekte zu erzeugen, die an musikalische, architektonische oder malerische Kompositionen erinnern. Durch die Verwendung von melodischen Rhythmen und mehrdeutiger Symbolik brachten sie facettenreiche Assoziationen und nuancierte Empfindungen zum Ausdruck.»24
In der «Nachfolge der französischen Symbolisten und vor allem Surrealisten» sieht Isabel Greschat Peter Chevalier.25 Dabei fällt der Name Odilon Redon. Der hegte, «losgelöst von jedweder akademischen Tradition und avantgardistischen Trends seiner Zeit»26 eine Vorliebe für das Traumhafte und Mystische. Dabei nahm er in erster Linie die alten Meister als Vorbilder für sein ‹Musée Imaginiaire›. Redon «rezipierte» überwiegend die Kunst der Renaissance, nach Originalen im Louvre und nach Photographien, was zu seiner Zeit üblich war: «Sehr viele Künstler aus Redons Generation kopierten im Louvre, z. B. Cézanne, Degas, Fantin-Latour, Manet, Berthe Morisot, Pissarro, Renoir, Moreau, Rodin etc.»27 Nach Italien fuhr Redon spät und auch nur zwei Male.
Peter Chevalier hingegen tat dies bereits in jungen Jahren.28 Auch ihn faszinieren die Alten Meister. «Das Interesse an fremdartigen, mehrdeutigen Bildern, die mit verborgenen Schichten der Seele korrespondieren und eine Fülle von Assoziationen auslösen, läßt ihn an die Innovationen dieser früheren Künstler anknüpfen und zieht sich wie ein roter Faden durch sein Werk.» Dabei verweist Isabel Greschat auf den surrealistischen Grundsatz, der Künstler erfinde eigentlich nichts Neues.29 Wie auch? Alles sei schon einmal gedacht (gemalt?), wird Kurt Tucholsky später lapidar feststellen.30
Symbolismus. Surrealismus. Auch die italienische pittura metafisica wird gerne mit Peter Chevalier in Verbindung gebracht. Peter Winter begibt sich sogar in die neuere Kunstgeschichte: «Bei einigen seiner Ölbilder spürt man, daß sich Peter Chevalier auch mit Arshile Gorky, Rufino Tomayo und Wifredo Lam beschäftigt hat, daß eventuell die Imaginationen Graham Sutherlands und der frühe Wols ebenfalls nicht spurlos an ihm vorübergegangen sind.»31 Genausogut ließe sich allerdings fragen, in welchem Museum oder sonstiger Umgebung die Bildinspirationen der Genannten nicht zu finden wären; die zeitgenössische Indiziensucherei nimmt bisweilen Züge an, die grotesker anmuten als manch ein Bildsujet. Auch der bildende Künstler nährt sich nunmal aus dem Napf der Erfahrungen, die andere vor ihm gemacht haben. Wie der Koch, der ins Sternenreich zu gelangen trachtet, kreiert er sie neu. Doch ohne das bewährt Irdische wird dem niemand ein besterntes Mützchen aufsetzen. Es ist alles eine Frage des Neu-Sehens. Zudem, so würdigt Johann-Karl Schmidt die Arbeit von Peter Chevalier: «Nirgends kann sich die Erkenntnis des Neugeschaffenen noch auf die Krücke des über die Sinne geführten Wiedererkennens stützen.»32
Wilhelm Bojescul fährt einen auffällig didaktischen Weg — um diese Malerei zu umschiffen: Ohne Peter Chevalier in eine «unerwünschte Nähe zur Abstraktion bringen zu wollen, ist festzustellen, daß in den Bildern scheinbar unterschiedliche Stilmittel existieren, daß Realistisches und Abstraktes konfrontiert werden [...]. Des öfteren fällt ein Schlagwort wie ‹metaphysische Malerei›, als wäre das Metaphysische der einzige Anlaß zur Malerei. [...] Meiner Meinung nach geht es Peter Chevalier primär um ein Interesse, sich als Maler im weitesten Sinne des Begriffes zu artikulieren, ohne an dieser oder jener Richtung anknüpfen zu wollen, geschweige denn zu müssen.»33
Statt (Er-)Klärung eine Nebelkerze. Denn das Gemälde an sich stellt bereits eine Abstraktion dar. Eine «unerwünschte Nähe» führt in die Irre, da Chevalier nunmal nichts anderes tut als das Wesentliche vom Unwesentlichen (und umgekehrt) zu trennen. Bojescul möchte für Chevalier die beiden geläufigen Begriffe Realismus und Abstraktion getrennt wissen. Letztere wird gerne rein geometrischen Wurzeln zugeordnet, erstere der Figur. Dabei gibt es doch ebenso eine (geometrisch anmutende) Farbfeldmalerei, die sich aus dem Figurativen entwickelt hat. Und auch wenn bei Chevalier die Figur im Vordergrund steht, so sehnt die sich nie nach Realität, sondern tritt immer die Flucht in den (Traum-)Raum an.
«Die Realität des Bildes ist», wie Bojescul an- bzw. bemerkt, «eine eigene Realität fern unserer Alltagsweit. Dem Betrachter wird die Relativität des Relativen vorgeführt. Es entsteht eine bildeigene Dialektik, die nur im Rahmen des Bildes logisch ist, die Großes klein werden läßt bzw. läßt sie auch Kleines groß erscheinen, wie zum Beispiel die menschliche Gestalt. Weitere Polaritätspaare, die in den Bildern vorhanden sind, sind nah und fern, hell und dunkel und schnell und langsam. Diese Polaritätspaare bewirken einen augenblicklichen monumentalen Zeitstillstand für den Betrachter, ohne daß die Bilder außerhalb der Zeit stünden. Die Zuordnung der Gegenstände orientiert sich grundsätzlich an der Bildfläche, die bewältigt werden muß. Somit wird deutlich, daß die Realität für den Maler zunächst einmal die Leinwand ist, auf die er seine Weltsicht bringt.»34
Weltsicht? «Egoversum» hat Christoph Rihs (seine) Kunst einmal (selbstironisch) genannt.35 Dem Maler, der nichts anderes sein will als das, wird sie zwangsläufig immer kleiner, diese Welt. Um jeden Quadratmillimeter kämpft er, um jede Darstellungsform des Geringsten noch, mit jedem Pinselstrich, um jede pastose Erhebung, um jede Farbnuancierung, um zu verdeutlichen, was das Geistige in ihm und damit in der Kunst ausmacht. Oft hat er, manchmal bereits über die Étude, in seinem Fall (als eigenständige Form) die Zeichnung, alles in Einklang, in einen Klang zu bringen versucht. Auch der Hilfe der Ölfarbe bedient er sich — denn sie ist ebenso Ausdrucksmittel, die sich in jedem Licht und über lange Zeit hin immer wieder verändert. Und damit das Egoversum, das ohnehin dazu neigt, sich ständig neu zu orientieren. Ex oriente lux — im Osten geht die Sonne auf ...
Räume, so nennt Peter Chevalier seine Bilder. Johann-Karl Schmidt nennt als Gundvoraussetzung für solches (weniger dem Dekorativen gewidmete) Raum-Schaffen das «Sehvermögen der Seele». Was die Seele sieht, ist, wie Schmidt meint, nicht Wirklichkeit, also spiegele sich darin auch keine solche. Auch dabei läßt sich ein anderer Standpunkt einnehmen. Zumindest haben seit Sigmund Freud hier einige Wirklichkeiten gesehen, die sich in der Seele wiederfinden. Gerade in den Träumen, so hat die traumdeutende Wissenschaft über die Jahrzehnte hin herausgefunden, wirft die Seele Wirklichkeiten aus, verarbeitet Geschehenes, aber durchaus auch Ahnungsvolles, Visionäres, Utopisches. Kunst kommt von Sehen, von dessen Umsetzen. Peter Chevaliers Seele, so sei spekuliert, sucht den Nicht-Ort. Hierbei gerät er ins Fahrwasser eines Sur-Realismus, der (auch) Symbole gebiert, auf der Suche nach Wahrheit Ergebnis einer Neben-Wirklichkeit. Darum ringt, kämpft er. Was sollte er als Maler auch anderes tun?
Und es geht wohl auch weniger darum, «Neues» zu «erfinden statt Gegebenes» zu «interpretieren». Wenn er Neues erfinden will als Künstler, der sein Päckchen auf den Markt tragen muß, dann mag es heißen: «[...] sich mit größerem Mut dem Wagnis des Scheiterns oder Gelingens auszusetzen, weil nichts dem Urteil mehr festen Halt irgendwo im Vertrauten anbietet».36 Wenn den Künstler aber Neues (über-)denkt, es ihn immer wieder das Alte neu träumt, das umzusetzen ihn immer wieder aufs neue zwingt, erneut anzusetzen, dann scheitert er allenfalls am Lager derer, die unter Kunst etwas so zwanghaft Neues verstehen, wie es vom Media-Markt erwartet wird. Aber letztlich kommt auch Johann-Karl Schmidt auf den entscheidenden Punkt: Wenn Peter Chevalier also «seine Bilder Räume nennt, so soll das nicht die von vornherein nutzlose Suche nach einer vielleicht vermittels perspektivischer Linien oder illusionistischer Kunstgriffe darin enthaltenen dritten Dimension auslösen. Raumfragen oder Raumillusionen, die Künstler und ihre Interpreten bis heute gern deklamieren, als ob sie Kernprobleme der Kunst wären, kommen hier nicht zur Sprache, weil Peter Chevaliers Bild einen Kunstraum und nicht einen Weltraum eröffnet.
In diesem Kunstraum aber verharren die Dinge nicht empirisch erfahrbar und nach ihrer physischen Natur, ihrem körperlichen Volumen, ihrem schwerkraftbedingten Gewicht statisch in die drei Dimensionen geordnet, sondern sie schweben ortlos und schwerefrei in flüchtigen Zuständen. Perspektive, Ordnung und Einheit: meist waren in der Neuzeit Vernunft oder Erfahrung Richtschnur künstlerischer Spekulation selbst dann noch, wenn deren Ziele, wie beim Surrealismus, im lrrationalen lagen. Bei Peter Chevaller stehen die Bilder selbst einer Rezeption über die Vernunft im Wege, denn sie sagen dem ordnungstiftenden Einheitspostulat, das seit den Bildungsgesetzen der Renaissance unsere Sehgewohnheiten prägt, ab. Dessen Preisgabe fordert jedoch viel vom Betrachter, nämlich erneut als ein Bild anzuerkennen, was doch den harmonischen Bildbegriff, wie er überkommen ist, bestreitet.»37
Es ist dieses (nur scheinbare) Paradoxon, das der Kunst innewohnt: sie erweitert das Blickfeld des Betrachters, schiebt den Horizont in weite, bisweilen sehr fremde Fernen. Als ob man sich aufmacht, das Zuhause des engen Gebirgstals oder der Stadtschlucht zum ersten Mal zu verlassen, um dorthin zu gehen, wo die Ankunft des Besuchers schon am Vortag wahrgenommen wird. Oder einfach ein paar Schritte hinaufgeht auf den Deich und mit einem Mal sieht, daß das Denken nie ein Ende haben wird, weil die Welt rund ist wie der Kopf. Was beileibe nicht heißen soll, daß der Gedanke deshalb ständig die Richtung ändern muß. Er geht lediglich seinen Weg. Auch der hat bekanntlich ein Ziel: hin zur Kunst, immer auf der Suche zu sich selbst: L'art pour l'art im ursprünglichen, eben romantischen Sinn — zweckfrei.
Auch in der Person, genauer: in der Malerei von Peter Chevalier zeichnet dieser Weg sich ab. Bestimmte früher noch «dieses», wie Peter Winter schreibt, «nordisch Schwere» die Sujets, zeigten bereits in den neunziger Jahren neue Arbeiten im «Gegensatz zu den Bildern der achtziger Jahre einen starken Mut zur Strahlkraft der Farbe».38 Mittlerweile sind nicht nur die Bildhintergründe heller geworden, auch die Formen geben mittlerweile ein wenig von ihren Geheimnissen preis. Beharrt die Metapher auch auf ihren angestammten Ort, so bietet sie sich doch zusehends als Schlüsselsymbol an für den bereitwilligen Betrachter. Die Hermetik ist keine absolute mehr. Die Erdenschwere löst sich langsam auf, die Gemälde sind leichter, zumindest lichter geworden. Die Vermutung steht an, Peter Chevalier verlasse die hugenottischen, calvinistisch-materialistischen Fluchten und sei fröhlicher, gelassener unterwegs — in der Ahnen Spuren. Vielleicht auf dem Weg an einen (katholischen) Atlantik?
Anmerkungen
1 Walter Vitt: Palermo starb auf Kurumba. Wider die Schlampigkeiten in Kunstpublikationen. aica ‹Schriften zur Kunstkritik›, Köln/Nördlingen 2003
2 Ein Beispiel nur: Kunstmarkt.com (11.12.2007)
3 Die Fauves hatten ihren Ursprung im zwischen 1910 und 1920 aufkommenden Expressionismus, zu deutsch ‹Wilde›; der damalige Direktor der Aachener Neuen Galerie, Wolfgang Becker, gab ihren Nachkommen den Namen Junge Wilde.
4 Aus diesem Gespräch und weiteren Gesprächen entstammen auch die Zitate, die hier nicht gesondert ausgewiesen sind.
5 Gespräch mit Walter Grasskamp, gedruckt in: Ursprung und Vision. Neue deutsche Malerei. Ausstellungskatalog Centre Cultural de la Caixa de Pensiones, Barcelona; Palacio Velasquez Madrid; Museo de Arte Moderna, Mexico City, 1984
6 Gespräch mit Walter Grasskamp, a. a. O.
7 Gespräch mit Walter Grasskamp, a. a. O.
8 der allerdings weniger mit Kunst als mit Naturgewalten zu tun hat: «norwegisch Moskenstraumen, starker Gezeitenstrom zwischen den südlichsten Lofotinseln (Nordnorwegen), kann bei Weststürmen und einem nach Westen setzenden Ebbstrom kleinere Schiffe gefährden» (lexikon.meyers.de) In den Künsten wird der Begriff jedoch gerne metaphorisch genutzt.
9 Gespräch mit Walter Grasskamp, a. a. O.
10 Gespräch mit Walter Grasskamp, a. a. O.
11 Detlef Bluemler: Gespräch mit Jochen Gerz am 4. Mai 1988 in Paris
12 Isabel Greschat: Geheimnisse des Paradieses und der Phantasie, in: Peter Chevalier, Bilder und Zeichnungen 1988 — 1997, Ausstellungskatalag Galerie der Stadt Stuttgart 1997, S. 15-21; Peter Winter: Versponnen im Craquelé der Assoziationen. Der Berliner Maler Peter Chevalier. Manuskript von 1996; keine Angaben, vermutlich für Die Zeit oder Frankfurter Allgemeine Zeitung
13 «Aber das Fragen der Malerei zielt in jedem Fall auf dieses verborgene und fieberhafte Entstehen der Gegenstände in unserem Körper», in: vor himmlischen erscheinungen schützt kein brett. Mit einem Text von Gerd Denger. Ausstellungskatalog Galerie Wolfgang Gmyrek, Düsseldorf 1993
14 Peter Chevalier. Peintures Dessins 1989 – 1990. Musée des Sables d'Olonne, Cahiers de l'Abbayes Sainte-Croix, Februar bis April 1990; Katalog
15 Mit der Zeile «Von der Maß bis an die Memel» in seinem Lied der Deutschen von 1841 wollte Hoffmann von Fallersleben das Ende der großen Kleinstaaterei, «Einigkeit und Recht und Freiheit» für alle Deutschen und damit eine deutsche (demokratische) Nation herbeigesungen haben.
16 Erst im September 2007 wertete Erzbischof Joachim Kardinal Meisner Gerhard Richters neues Kölner Dom-Fenster als zu «abstrakt» und predigte im Zusammenhang mit dem neuen Kolumba-Museum in Köln: Dort, «wo die Kultur von der Gottesverehrung abgekoppelt wird», entarte sie.
17 Das französische Wort chose umfaßt allerdings weitaus umfangreichere Darstellungsmöglichkeiten, sowohl umgangssprachlich als auch in der Poesie.
18 Siehe auch: Sabine Mainberger: Schreibtischporträts. Zu Texten von Arno Schmidt, Georges Perec, Hermann Burger und Francis Ponge, in: B. Siegert/J. Vogl (Hrsg.): Europa. Kultur der Sekretäre, Zürich/Berlin 2003, 175-192
19 Francis Ponge: My creative method. Sidi-Madani, Donnerstag, den 18. November 1947, in: Einführung in den Kieselstein und andere Texte. Französisch und deutsch. Mit einem Aufsatz von Jean-Paul Sartre. Übertragen von Gerd Henniger und Katharina Spann. Frankfurt am Main 1986, S. 189
20 Francis Ponge: Die Auster (l'huitre), in: Einführung in den Kieselstein und andere Texte, a. a. O., S. 51
21 Francis Ponge: Schnecken (Escargots), a. a. O., S. 61f.
22 Es kann aber auch Victor Cousin gewesen sein, der den Begriff gepägt hat.
23 Wenn sie nicht, wie häufig geschehen, etwa mittels romantizistisch-romantisierender Schönheit wie bei Carlo Schmitt oder anderen, insofern totübersetzt wurden, als die bösen, kranken Blumen allzu blumig dahinwelkten. Alle möglichen Übersetzer haben sich daran versucht, die meisten sind gescheitert. In der schönen Suhrkamp-Insel-Ausgabe von 1973 hat Sigmar Löffler die Übertragung vorgenommen, und die hat den Vorteil, zweisprachig zu sein.
24 Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé, Paul Bourget, Artur Rimbau, Gustave Kahn, Henri de Régnier, Jules Laforgue, Francis Jammes und Jean Moréas. Gert Pinkernell: Dichtung des 19. Jahrhunderts, Symbolismus, in: Frankreich-Experte.de (30.08.2007)
25 Isabel Greschat: a. a. O.
26 Isa Bickmann: Odilon Redon und die Kunst der italienischen Renaisance. Magisterarbeit, Philipps-Universität Marburg 1993, S. 60
27 Bickmann, a. a. O., S. 4 + 58
28 Peter Winter meint dazu: Wegen «[...] seines einstigen Lehrers Hermann Albert, der beinahe seine gesamte Malklasse mit dem Bazillus der Italienleidenschaft angesteckt hatte». Versponnen im Craquelé der Assoziationen, a. a. O.
29 Isabel Greschat: Geheimnisse des Paradieses und der Phantasie, a. a. O., S. 15
30 Kurt Tucholsky: Es gibt keinen Neuschnee, in: Gesammelte Werke 1925 – 1926, Reinbek 1993 (181. Aufl.), Bd. 9, S 74f. Aber war das (auch) nichts Neues, das Tucholsky da hervorgebracht hat?
31 Peter Winter, Versponnen im Craquelé der Assoziationen, a. a. O.
32 Johann-Karl Schmidt: Peter Chevalier — Über das Sehvermögen der Seele, in: Peter Chevalier, Bilder und Zeichnungen 1988 – 1997, Ausstellungskatalag Galerie der Stadt Stuttgart 1997, S. 11-14, hier: S. 11
33 Wilhelm Bojescul: Vom Eigenleben der Bilder, in: Peter Chevalier. Bilder und Zeichnungen. Ausstellungs-Katalog Kunstverein Braunschweig. 7. 11.1986 – 4. 01.1987, S. 7
34 Bojescul, a. a. O., S. 8
35 Poetische Vernunft. Detlef Bluemler über Christoph Rihs, in: Künstler. Kritisches Lexikon der Gegenwartskunst, Ausgabe 60, 2002, Heft 31, S. 10; La raison poétique (en français)
36 Johann-Karl Schmidt, a. a. O.
37 Johann-Karl Schmidt, a. a. O.
38 Peter Winter, a. a. O.
Künstler — Kritisches Lexikon der Gegenwartskunst, Ausgabe 80. 4. Quartal (Dezember), Heft 25, München 2007
© Für den Text: Detlef Bluemler und Zeitverlag;
für die Chevalier-Abbildungen: © Peter Chevalier, © VG Bild-Kunst, Bonn; Portrait-Photographie: © Detlef Bluemler
Chevalier gehörte, nachdem er 1980 vom Studienort Braunschweig, nicht zuletzt auf Rat seines Lehrers Hermann Albert, nach Berlin übergesiedelt war, eben nicht zu denen, die in «dem ganzen Zirkus»5 mitturnten. Zu dieser Zeit ergab es sich, daß «unheimlich viele Maler nach Berlin [kamen], zum Beispiel vom Lüpertz aus Karlsruhe, die haben weder weitergemalt noch sonst was gemacht. Die wurden einfach von der Stadt erdrückt».6 Mit einem ehemaligen Studenten von Markus Lüpertz hatte er auch anfänglich das erste Atelier gemeinsam. Doch «der kam einfach mit der Situation nicht zurecht. Da läufst du vom Kottbusser Tor hierher, von der U-Bahn, da bist du natürlich extrem einsam. Dann sollst du noch malen, oder wie?»7
Chevalier hat sich von der damaligen Hektik, der Geschwindigkeit auf dieser Insel inmitten des politischen Malstroms8 nicht mitreißen lassen. Die durch die Wusseligkeit, manchmal auch aufgepropfte Wildheit dieser Stadt entstandene Angriffslust, verursacht sicherlich nicht zuletzt durch die (geo-)politisch bedingte Ausnahmesituation, richtete er auf sich. «Man muß eine ganz bestimmte Aggression haben, hauptsächlich gegen sich selber [...]. Wenn du die nicht hast, brauchst du erst gar nicht den Pinsel anrühren.»9 Selbst-disziplinierung war es wohl, die ihn konzentriert hat malen lassen. Aber eben keine Gefühle. «Ich will», sagte er bereits in den turbulenteren Anfangszeiten, «keine exhibitionistischen Bilder malen.»10 Gefühlspornographie auf Leinwand ist bis heute nicht seine Welt. Seine Bilder zeigen Innen-Leben.
Das heißt nun keineswegs, mit Peter Chevalier einen in sich und sein Atelier zurückgezogenen Maler vorzufinden, der sich einer romantizistischen Attitüde hingibt. Ein Romantiker ist er gleichwohl. Doch Romantik ist nunmal anderen Ursprungs, als das landläufig schlichte Bild von ihr hergibt. Jochen Gerz hat dieses langlebige Mißverständnis korrigiert: «In der Romantik kommt es zur Panne des Auftrags, eigentlich ein schöner Moment, unglaublich scharf und ohne jede Entschuldigung. Scharfgestellt wird auf die Kunst, und was da steht, nackt und alleine, das ist eben die Kunst. Die Kunst ohne Dauer, Publikum, Auftrag. [...] Das entspricht einem fast französischen Begriff des Politisierten. [...] Das allerwichtigste: daß sie eine relativ würdige, unexpressive Haltung eingehalten haben des totalen Fehlens von Anlaß zu Hoffnung. Die Romantiker waren total getrennt von ihrer Liebe, ihrer Sehnsucht, ihrem Verlangen nach Ursprung oder Zukunft, von ihrem eigenen Bewußtsein, von ihrem Programm, und ohne zu klagen und zu lamentieren und ohne sich zu verbohémisieren haben sie das ausgehalten.»11
Die Romantik ist gekennzeichnet von der Sehnsucht. Weit hinten liegt das Innen. Es zeigt sich in einer sich immer weiter hinausschiebenden Ferne. Nur wer ihr nachzugehen bereit ist, wird den Brennpunkt erkennen. Zunächst jedoch ist er verriegelt mittels der ihm eigenen Symbolik. Nur wer die Metapher geknackt hat, vermag sie auszuleuchten.
Chevaliers Malerei wird, wohl wegen Symbol und Metapher, immer wieder als französisch bezeichnet, beispielsweise bei Isabel Greschat und Peter Winter.12 Auch Chevalier selbst streift das Land immer wieder mal, allerdings meist dann, wenn es um Literatur geht. Georges Simenon erwähnt er, den er in der Schulzeit gelesen hat. Maurice Merleau-Ponty, den großen Philosophen und Phänomenologen, des Forschers der Wahrnehmung, zitiert er.13 Auf Julien Green, den letzten Amerikaner in Paris, der dort auch geboren wurde, der dort gelebt und in französischer Sprache geschrieben und wohl auch geträumt hat, kommt er zurück. Auch Francis Ponge fällt ein ins Gespräch, der 1988 gestorbene Schriftsteller, der geschrieben hat, wie andere malen.
Interessanterweise hat Chevalier mit Frankreich ansonsten nicht sonderlich viel im Sinn. Sicher, einen Studienaufanthalt Ende der achtziger Jahre in der Vendée gab es, an den er sich gerne erinnert, in Les Sables d'Olonne, einem atlantiknahen Städtchen unweit der Protestantenhochburg La Rochelle. Im Museum, einem ehemaligen romanischen Kloster, hatte er dann auch eine Ausstellung seiner Gemälde und Zeichnungen.14
Doch da ist der französische Name. Ein hugenottischer ist's. Hugenotten flüchteten (zuletzt) Ende des 17. Jahrhunderts zuhauf auch nach Deutschland, korrekt: in deutsche Länder; damals gab es das Deutschland noch nicht, das heute bekannt ist.15 So kam ein Teil von ihnen ins Badische. Und von dort stammt Peter Chevalier.
Hugenotten waren Protestanten, genauer: Calvinisten, recht rabiate Vertreter einer Offenbarungslehre, die jedweden Kult(us) ablehnten, deren Hölle die des völligen Verzichtes auf alles ist und deshalb für viele noch ärger brennt als die katholische, zumal die die Beichte kennt und den Ablaß. Ob der ins Hugenottische verbannte Peter Chevalier sich deshalb nach der katholischen Wurzel sehnt? Ist er auf dem Weg zum sehr späten Konvertiten in die Vergangenheit?
Nun sind seine Gemälde nicht eben ausgeprägt katholisch, schon gar nicht erfüllt von hymnischem Laudate. Als ob er seiner Verehrung nicht traute, versteckt er den Kultus in einem üppigen Protestantismus. Doch auch hier schimmert eine Sehnsucht durch: «Es ist faszinierend, daß es in der Kirche so viele Bilder gibt und gab — wie die katholische Kirche mit den Künstlern umgegangen ist. Das ist das Gegenteil vom Protestantismus.»
Nun darf man anderer Meinung sein über den früheren, aber durchaus auch aktuellen Umgang der katholischen Kirche mit Kunst und Künstlern. Richtig ist wohl, die Malerei gäbe es ohne Päpste beziehungsweise Kardinäle respektive Fürsten und Grafen nicht, die ebenso der Kirche ergeben waren, die ja für den unabdingbaren Glauben stand. Es gab nichts Höheres als die Kirche. Nur Gott stand darüber. Und wer, wie die Hugenotten etwa, anders geartet glaubte oder, später, der Vernunft ergeben war, befand sich im Bund mit dem Teufel und wurde auch schon mal gevierteilt oder sonstwie massakriert. Durch die Kirche, die katholische. Kirche bedeutete Allmacht. Und Kunst bedeutet(e), vereinfacht formuliert: Huldigung Gottes. So sieht das auch ein regierender Kirchenoberer des 21. Jahrhunderts.16 Das war der Kult, den die Protestanten abgeschafft wissen woll(t)en und den viele Katholiken heute vermissen. Deshalb wohl wird mancherorts die Messe wieder lateinisch gelesen.
Ist es das Mystische in diesem Umfeld, das Peter Chevalier anzieht? Das Mysterium Malerei?
Francis Ponge. Er hat zwar nicht gemalt. Aber er hat sich in seiner Dichtung, in seinen Essais den ‹Dingen›17 suchend, (be-)schreibend genähert. «Die Texte wollen den Gegenständen ähnliche Objekte aus Sprache sein [...] als eine Art Definition und Deskription alltäglicher Dinge [...].»18 Ähnlich, so ließe es sich betrachten, geht Peter Chevalier in seiner Malerei vor. Wenn seine Gegenstände auch andere sind als die des Alltags, der sogenannten Wirklichkeit.
Ponge schreibt von sich ein Bild, das eine Nähe zu Chevalier darstellen könnte: «[...] Die am besten begründeten Ansichten, die harmonischsten (bestgebauten) philosophischen Systeme sind mir immer völlig brüchig vorgekommen, haben bei mir einen gewissen Widerwillen, der unbestimmt an die Seele griff, ein peinliches Gefühl der Unbeständigkeit hervorgerufen. [...] So erscheinen mir die Ideen an und für sich als das, wozu ich am wenigsten befähigt bin, und sie interessieren mich kaum.»19 Die Dinge an sich interessierten ihn, die Welt in den Dingen, zum Beispiel in der Auster:
«Drinnen findet man eine ganze Welt, zu essen und zu trinken: unter einem Firmament (im eigentlichen Wortsinn) aus Perlmutt senken sich die Oberhimmel auf die Unterhimmel und bilden mit ihnen eine einzige Lache, einen grünlichen, klebrig-zähen Beutel, der für Geruchssinn und Auge schwillt und sinkt, am Ufersaum mit schwärzlichen Spitzen besetzt.»20
So tastet sich auch der Maler langsam an die Innenwelt der Dinge heran. Die Form an sich spielt eine Nebenrolle. Denn die ergibt sich ohnehin beziehungsweise ändert sich fortwährend während der Suche nach dem Wesen der Dinge. Von Ponge wird bisweilen behauptet, er schreibe nicht auf die Metapher hin. Auch das kann man anders sehen. Denn sie entsteht in seiner Gegenstands-Beschreibung letztendlich doch. Chevalier malt den Gegenstand des Un-Eigentlichen. Auf der Suche danach führt es ihn zu Wesentlichem, das sich in einer symbolartigen Figur ausdrückt, die einen eigen-artigen Raum benötigt. Die Schnecken von Francis Ponge drängen sich auf: «Als Heilige machen sie ihr Leben zum Kunstwerk — ihre Vervollkommnung zum Kunstwerk. Sogar ihre Sekretion geschieht derart, daß sie zur Form gerät.»21 Peter Chevalier muß sich auf diesen Mal-Spuren befinden.
Théophile Gautier. Ihm wird das mindestens so oft wie der Begriff Romantik mißbrauchte, zumindest aber mißverstandene L'art pour l'art22 zugeschrieben, einer Kunst, die sich selbst genügt und frei von Markt, Moral und gesellschaftlicher Verantwortung ist. Am deutlichsten hat sich die Kunst um der Kunst willen in der Dichtung von Charles Baudelaire gezeigt, dieser romantische Schöpfer der Antipoden der romantischen Blauen Blume, der Bösen Blumen, diesen ungeheuerlichen, die Ästhetik des sogenannt Häßlichen besingenden, selbst in deutscher Übersetzung noch sprachgewaltigen Gedichten Les Fleurs du Mal.23 Es verneint alles, was dem Verständnis, der Erkenntnis zuträglich sein könnte. Baudelaire verwendet keinerlei genaue Beschreibung, er ergeht sich in (alp-)traumartigen Verfremdungen. «Die Empfindungen», so Gert Pinkernell, «die durch diese Symbole ausgelöst werden, sollen dem Wesen der Idee entsprechen und neue Ebenen hinter der scheinbaren Realität aufdecken. Den Symbolisten [...] gelang es mit Hilfe ihrer fließenden Sprache Effekte zu erzeugen, die an musikalische, architektonische oder malerische Kompositionen erinnern. Durch die Verwendung von melodischen Rhythmen und mehrdeutiger Symbolik brachten sie facettenreiche Assoziationen und nuancierte Empfindungen zum Ausdruck.»24
In der «Nachfolge der französischen Symbolisten und vor allem Surrealisten» sieht Isabel Greschat Peter Chevalier.25 Dabei fällt der Name Odilon Redon. Der hegte, «losgelöst von jedweder akademischen Tradition und avantgardistischen Trends seiner Zeit»26 eine Vorliebe für das Traumhafte und Mystische. Dabei nahm er in erster Linie die alten Meister als Vorbilder für sein ‹Musée Imaginiaire›. Redon «rezipierte» überwiegend die Kunst der Renaissance, nach Originalen im Louvre und nach Photographien, was zu seiner Zeit üblich war: «Sehr viele Künstler aus Redons Generation kopierten im Louvre, z. B. Cézanne, Degas, Fantin-Latour, Manet, Berthe Morisot, Pissarro, Renoir, Moreau, Rodin etc.»27 Nach Italien fuhr Redon spät und auch nur zwei Male.
Peter Chevalier hingegen tat dies bereits in jungen Jahren.28 Auch ihn faszinieren die Alten Meister. «Das Interesse an fremdartigen, mehrdeutigen Bildern, die mit verborgenen Schichten der Seele korrespondieren und eine Fülle von Assoziationen auslösen, läßt ihn an die Innovationen dieser früheren Künstler anknüpfen und zieht sich wie ein roter Faden durch sein Werk.» Dabei verweist Isabel Greschat auf den surrealistischen Grundsatz, der Künstler erfinde eigentlich nichts Neues.29 Wie auch? Alles sei schon einmal gedacht (gemalt?), wird Kurt Tucholsky später lapidar feststellen.30
Symbolismus. Surrealismus. Auch die italienische pittura metafisica wird gerne mit Peter Chevalier in Verbindung gebracht. Peter Winter begibt sich sogar in die neuere Kunstgeschichte: «Bei einigen seiner Ölbilder spürt man, daß sich Peter Chevalier auch mit Arshile Gorky, Rufino Tomayo und Wifredo Lam beschäftigt hat, daß eventuell die Imaginationen Graham Sutherlands und der frühe Wols ebenfalls nicht spurlos an ihm vorübergegangen sind.»31 Genausogut ließe sich allerdings fragen, in welchem Museum oder sonstiger Umgebung die Bildinspirationen der Genannten nicht zu finden wären; die zeitgenössische Indiziensucherei nimmt bisweilen Züge an, die grotesker anmuten als manch ein Bildsujet. Auch der bildende Künstler nährt sich nunmal aus dem Napf der Erfahrungen, die andere vor ihm gemacht haben. Wie der Koch, der ins Sternenreich zu gelangen trachtet, kreiert er sie neu. Doch ohne das bewährt Irdische wird dem niemand ein besterntes Mützchen aufsetzen. Es ist alles eine Frage des Neu-Sehens. Zudem, so würdigt Johann-Karl Schmidt die Arbeit von Peter Chevalier: «Nirgends kann sich die Erkenntnis des Neugeschaffenen noch auf die Krücke des über die Sinne geführten Wiedererkennens stützen.»32
Wilhelm Bojescul fährt einen auffällig didaktischen Weg — um diese Malerei zu umschiffen: Ohne Peter Chevalier in eine «unerwünschte Nähe zur Abstraktion bringen zu wollen, ist festzustellen, daß in den Bildern scheinbar unterschiedliche Stilmittel existieren, daß Realistisches und Abstraktes konfrontiert werden [...]. Des öfteren fällt ein Schlagwort wie ‹metaphysische Malerei›, als wäre das Metaphysische der einzige Anlaß zur Malerei. [...] Meiner Meinung nach geht es Peter Chevalier primär um ein Interesse, sich als Maler im weitesten Sinne des Begriffes zu artikulieren, ohne an dieser oder jener Richtung anknüpfen zu wollen, geschweige denn zu müssen.»33
Statt (Er-)Klärung eine Nebelkerze. Denn das Gemälde an sich stellt bereits eine Abstraktion dar. Eine «unerwünschte Nähe» führt in die Irre, da Chevalier nunmal nichts anderes tut als das Wesentliche vom Unwesentlichen (und umgekehrt) zu trennen. Bojescul möchte für Chevalier die beiden geläufigen Begriffe Realismus und Abstraktion getrennt wissen. Letztere wird gerne rein geometrischen Wurzeln zugeordnet, erstere der Figur. Dabei gibt es doch ebenso eine (geometrisch anmutende) Farbfeldmalerei, die sich aus dem Figurativen entwickelt hat. Und auch wenn bei Chevalier die Figur im Vordergrund steht, so sehnt die sich nie nach Realität, sondern tritt immer die Flucht in den (Traum-)Raum an.
«Die Realität des Bildes ist», wie Bojescul an- bzw. bemerkt, «eine eigene Realität fern unserer Alltagsweit. Dem Betrachter wird die Relativität des Relativen vorgeführt. Es entsteht eine bildeigene Dialektik, die nur im Rahmen des Bildes logisch ist, die Großes klein werden läßt bzw. läßt sie auch Kleines groß erscheinen, wie zum Beispiel die menschliche Gestalt. Weitere Polaritätspaare, die in den Bildern vorhanden sind, sind nah und fern, hell und dunkel und schnell und langsam. Diese Polaritätspaare bewirken einen augenblicklichen monumentalen Zeitstillstand für den Betrachter, ohne daß die Bilder außerhalb der Zeit stünden. Die Zuordnung der Gegenstände orientiert sich grundsätzlich an der Bildfläche, die bewältigt werden muß. Somit wird deutlich, daß die Realität für den Maler zunächst einmal die Leinwand ist, auf die er seine Weltsicht bringt.»34
Weltsicht? «Egoversum» hat Christoph Rihs (seine) Kunst einmal (selbstironisch) genannt.35 Dem Maler, der nichts anderes sein will als das, wird sie zwangsläufig immer kleiner, diese Welt. Um jeden Quadratmillimeter kämpft er, um jede Darstellungsform des Geringsten noch, mit jedem Pinselstrich, um jede pastose Erhebung, um jede Farbnuancierung, um zu verdeutlichen, was das Geistige in ihm und damit in der Kunst ausmacht. Oft hat er, manchmal bereits über die Étude, in seinem Fall (als eigenständige Form) die Zeichnung, alles in Einklang, in einen Klang zu bringen versucht. Auch der Hilfe der Ölfarbe bedient er sich — denn sie ist ebenso Ausdrucksmittel, die sich in jedem Licht und über lange Zeit hin immer wieder verändert. Und damit das Egoversum, das ohnehin dazu neigt, sich ständig neu zu orientieren. Ex oriente lux — im Osten geht die Sonne auf ...
Räume, so nennt Peter Chevalier seine Bilder. Johann-Karl Schmidt nennt als Gundvoraussetzung für solches (weniger dem Dekorativen gewidmete) Raum-Schaffen das «Sehvermögen der Seele». Was die Seele sieht, ist, wie Schmidt meint, nicht Wirklichkeit, also spiegele sich darin auch keine solche. Auch dabei läßt sich ein anderer Standpunkt einnehmen. Zumindest haben seit Sigmund Freud hier einige Wirklichkeiten gesehen, die sich in der Seele wiederfinden. Gerade in den Träumen, so hat die traumdeutende Wissenschaft über die Jahrzehnte hin herausgefunden, wirft die Seele Wirklichkeiten aus, verarbeitet Geschehenes, aber durchaus auch Ahnungsvolles, Visionäres, Utopisches. Kunst kommt von Sehen, von dessen Umsetzen. Peter Chevaliers Seele, so sei spekuliert, sucht den Nicht-Ort. Hierbei gerät er ins Fahrwasser eines Sur-Realismus, der (auch) Symbole gebiert, auf der Suche nach Wahrheit Ergebnis einer Neben-Wirklichkeit. Darum ringt, kämpft er. Was sollte er als Maler auch anderes tun?
Und es geht wohl auch weniger darum, «Neues» zu «erfinden statt Gegebenes» zu «interpretieren». Wenn er Neues erfinden will als Künstler, der sein Päckchen auf den Markt tragen muß, dann mag es heißen: «[...] sich mit größerem Mut dem Wagnis des Scheiterns oder Gelingens auszusetzen, weil nichts dem Urteil mehr festen Halt irgendwo im Vertrauten anbietet».36 Wenn den Künstler aber Neues (über-)denkt, es ihn immer wieder das Alte neu träumt, das umzusetzen ihn immer wieder aufs neue zwingt, erneut anzusetzen, dann scheitert er allenfalls am Lager derer, die unter Kunst etwas so zwanghaft Neues verstehen, wie es vom Media-Markt erwartet wird. Aber letztlich kommt auch Johann-Karl Schmidt auf den entscheidenden Punkt: Wenn Peter Chevalier also «seine Bilder Räume nennt, so soll das nicht die von vornherein nutzlose Suche nach einer vielleicht vermittels perspektivischer Linien oder illusionistischer Kunstgriffe darin enthaltenen dritten Dimension auslösen. Raumfragen oder Raumillusionen, die Künstler und ihre Interpreten bis heute gern deklamieren, als ob sie Kernprobleme der Kunst wären, kommen hier nicht zur Sprache, weil Peter Chevaliers Bild einen Kunstraum und nicht einen Weltraum eröffnet.
In diesem Kunstraum aber verharren die Dinge nicht empirisch erfahrbar und nach ihrer physischen Natur, ihrem körperlichen Volumen, ihrem schwerkraftbedingten Gewicht statisch in die drei Dimensionen geordnet, sondern sie schweben ortlos und schwerefrei in flüchtigen Zuständen. Perspektive, Ordnung und Einheit: meist waren in der Neuzeit Vernunft oder Erfahrung Richtschnur künstlerischer Spekulation selbst dann noch, wenn deren Ziele, wie beim Surrealismus, im lrrationalen lagen. Bei Peter Chevaller stehen die Bilder selbst einer Rezeption über die Vernunft im Wege, denn sie sagen dem ordnungstiftenden Einheitspostulat, das seit den Bildungsgesetzen der Renaissance unsere Sehgewohnheiten prägt, ab. Dessen Preisgabe fordert jedoch viel vom Betrachter, nämlich erneut als ein Bild anzuerkennen, was doch den harmonischen Bildbegriff, wie er überkommen ist, bestreitet.»37
Es ist dieses (nur scheinbare) Paradoxon, das der Kunst innewohnt: sie erweitert das Blickfeld des Betrachters, schiebt den Horizont in weite, bisweilen sehr fremde Fernen. Als ob man sich aufmacht, das Zuhause des engen Gebirgstals oder der Stadtschlucht zum ersten Mal zu verlassen, um dorthin zu gehen, wo die Ankunft des Besuchers schon am Vortag wahrgenommen wird. Oder einfach ein paar Schritte hinaufgeht auf den Deich und mit einem Mal sieht, daß das Denken nie ein Ende haben wird, weil die Welt rund ist wie der Kopf. Was beileibe nicht heißen soll, daß der Gedanke deshalb ständig die Richtung ändern muß. Er geht lediglich seinen Weg. Auch der hat bekanntlich ein Ziel: hin zur Kunst, immer auf der Suche zu sich selbst: L'art pour l'art im ursprünglichen, eben romantischen Sinn — zweckfrei.
Auch in der Person, genauer: in der Malerei von Peter Chevalier zeichnet dieser Weg sich ab. Bestimmte früher noch «dieses», wie Peter Winter schreibt, «nordisch Schwere» die Sujets, zeigten bereits in den neunziger Jahren neue Arbeiten im «Gegensatz zu den Bildern der achtziger Jahre einen starken Mut zur Strahlkraft der Farbe».38 Mittlerweile sind nicht nur die Bildhintergründe heller geworden, auch die Formen geben mittlerweile ein wenig von ihren Geheimnissen preis. Beharrt die Metapher auch auf ihren angestammten Ort, so bietet sie sich doch zusehends als Schlüsselsymbol an für den bereitwilligen Betrachter. Die Hermetik ist keine absolute mehr. Die Erdenschwere löst sich langsam auf, die Gemälde sind leichter, zumindest lichter geworden. Die Vermutung steht an, Peter Chevalier verlasse die hugenottischen, calvinistisch-materialistischen Fluchten und sei fröhlicher, gelassener unterwegs — in der Ahnen Spuren. Vielleicht auf dem Weg an einen (katholischen) Atlantik?
Anmerkungen
1 Walter Vitt: Palermo starb auf Kurumba. Wider die Schlampigkeiten in Kunstpublikationen. aica ‹Schriften zur Kunstkritik›, Köln/Nördlingen 2003
2 Ein Beispiel nur: Kunstmarkt.com (11.12.2007)
3 Die Fauves hatten ihren Ursprung im zwischen 1910 und 1920 aufkommenden Expressionismus, zu deutsch ‹Wilde›; der damalige Direktor der Aachener Neuen Galerie, Wolfgang Becker, gab ihren Nachkommen den Namen Junge Wilde.
4 Aus diesem Gespräch und weiteren Gesprächen entstammen auch die Zitate, die hier nicht gesondert ausgewiesen sind.
5 Gespräch mit Walter Grasskamp, gedruckt in: Ursprung und Vision. Neue deutsche Malerei. Ausstellungskatalog Centre Cultural de la Caixa de Pensiones, Barcelona; Palacio Velasquez Madrid; Museo de Arte Moderna, Mexico City, 1984
6 Gespräch mit Walter Grasskamp, a. a. O.
7 Gespräch mit Walter Grasskamp, a. a. O.
8 der allerdings weniger mit Kunst als mit Naturgewalten zu tun hat: «norwegisch Moskenstraumen, starker Gezeitenstrom zwischen den südlichsten Lofotinseln (Nordnorwegen), kann bei Weststürmen und einem nach Westen setzenden Ebbstrom kleinere Schiffe gefährden» (lexikon.meyers.de) In den Künsten wird der Begriff jedoch gerne metaphorisch genutzt.
9 Gespräch mit Walter Grasskamp, a. a. O.
10 Gespräch mit Walter Grasskamp, a. a. O.
11 Detlef Bluemler: Gespräch mit Jochen Gerz am 4. Mai 1988 in Paris
12 Isabel Greschat: Geheimnisse des Paradieses und der Phantasie, in: Peter Chevalier, Bilder und Zeichnungen 1988 — 1997, Ausstellungskatalag Galerie der Stadt Stuttgart 1997, S. 15-21; Peter Winter: Versponnen im Craquelé der Assoziationen. Der Berliner Maler Peter Chevalier. Manuskript von 1996; keine Angaben, vermutlich für Die Zeit oder Frankfurter Allgemeine Zeitung
13 «Aber das Fragen der Malerei zielt in jedem Fall auf dieses verborgene und fieberhafte Entstehen der Gegenstände in unserem Körper», in: vor himmlischen erscheinungen schützt kein brett. Mit einem Text von Gerd Denger. Ausstellungskatalog Galerie Wolfgang Gmyrek, Düsseldorf 1993
14 Peter Chevalier. Peintures Dessins 1989 – 1990. Musée des Sables d'Olonne, Cahiers de l'Abbayes Sainte-Croix, Februar bis April 1990; Katalog
15 Mit der Zeile «Von der Maß bis an die Memel» in seinem Lied der Deutschen von 1841 wollte Hoffmann von Fallersleben das Ende der großen Kleinstaaterei, «Einigkeit und Recht und Freiheit» für alle Deutschen und damit eine deutsche (demokratische) Nation herbeigesungen haben.
16 Erst im September 2007 wertete Erzbischof Joachim Kardinal Meisner Gerhard Richters neues Kölner Dom-Fenster als zu «abstrakt» und predigte im Zusammenhang mit dem neuen Kolumba-Museum in Köln: Dort, «wo die Kultur von der Gottesverehrung abgekoppelt wird», entarte sie.
17 Das französische Wort chose umfaßt allerdings weitaus umfangreichere Darstellungsmöglichkeiten, sowohl umgangssprachlich als auch in der Poesie.
18 Siehe auch: Sabine Mainberger: Schreibtischporträts. Zu Texten von Arno Schmidt, Georges Perec, Hermann Burger und Francis Ponge, in: B. Siegert/J. Vogl (Hrsg.): Europa. Kultur der Sekretäre, Zürich/Berlin 2003, 175-192
19 Francis Ponge: My creative method. Sidi-Madani, Donnerstag, den 18. November 1947, in: Einführung in den Kieselstein und andere Texte. Französisch und deutsch. Mit einem Aufsatz von Jean-Paul Sartre. Übertragen von Gerd Henniger und Katharina Spann. Frankfurt am Main 1986, S. 189
20 Francis Ponge: Die Auster (l'huitre), in: Einführung in den Kieselstein und andere Texte, a. a. O., S. 51
21 Francis Ponge: Schnecken (Escargots), a. a. O., S. 61f.
22 Es kann aber auch Victor Cousin gewesen sein, der den Begriff gepägt hat.
23 Wenn sie nicht, wie häufig geschehen, etwa mittels romantizistisch-romantisierender Schönheit wie bei Carlo Schmitt oder anderen, insofern totübersetzt wurden, als die bösen, kranken Blumen allzu blumig dahinwelkten. Alle möglichen Übersetzer haben sich daran versucht, die meisten sind gescheitert. In der schönen Suhrkamp-Insel-Ausgabe von 1973 hat Sigmar Löffler die Übertragung vorgenommen, und die hat den Vorteil, zweisprachig zu sein.
24 Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé, Paul Bourget, Artur Rimbau, Gustave Kahn, Henri de Régnier, Jules Laforgue, Francis Jammes und Jean Moréas. Gert Pinkernell: Dichtung des 19. Jahrhunderts, Symbolismus, in: Frankreich-Experte.de (30.08.2007)
25 Isabel Greschat: a. a. O.
26 Isa Bickmann: Odilon Redon und die Kunst der italienischen Renaisance. Magisterarbeit, Philipps-Universität Marburg 1993, S. 60
27 Bickmann, a. a. O., S. 4 + 58
28 Peter Winter meint dazu: Wegen «[...] seines einstigen Lehrers Hermann Albert, der beinahe seine gesamte Malklasse mit dem Bazillus der Italienleidenschaft angesteckt hatte». Versponnen im Craquelé der Assoziationen, a. a. O.
29 Isabel Greschat: Geheimnisse des Paradieses und der Phantasie, a. a. O., S. 15
30 Kurt Tucholsky: Es gibt keinen Neuschnee, in: Gesammelte Werke 1925 – 1926, Reinbek 1993 (181. Aufl.), Bd. 9, S 74f. Aber war das (auch) nichts Neues, das Tucholsky da hervorgebracht hat?
31 Peter Winter, Versponnen im Craquelé der Assoziationen, a. a. O.
32 Johann-Karl Schmidt: Peter Chevalier — Über das Sehvermögen der Seele, in: Peter Chevalier, Bilder und Zeichnungen 1988 – 1997, Ausstellungskatalag Galerie der Stadt Stuttgart 1997, S. 11-14, hier: S. 11
33 Wilhelm Bojescul: Vom Eigenleben der Bilder, in: Peter Chevalier. Bilder und Zeichnungen. Ausstellungs-Katalog Kunstverein Braunschweig. 7. 11.1986 – 4. 01.1987, S. 7
34 Bojescul, a. a. O., S. 8
35 Poetische Vernunft. Detlef Bluemler über Christoph Rihs, in: Künstler. Kritisches Lexikon der Gegenwartskunst, Ausgabe 60, 2002, Heft 31, S. 10; La raison poétique (en français)
36 Johann-Karl Schmidt, a. a. O.
37 Johann-Karl Schmidt, a. a. O.
38 Peter Winter, a. a. O.
Künstler — Kritisches Lexikon der Gegenwartskunst, Ausgabe 80. 4. Quartal (Dezember), Heft 25, München 2007
© Für den Text: Detlef Bluemler und Zeitverlag;
für die Chevalier-Abbildungen: © Peter Chevalier, © VG Bild-Kunst, Bonn; Portrait-Photographie: © Detlef Bluemler
| Sa, 02.01.2010 | link | (3112) | 0 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Bildende Kunst |
Plastik in der Stadt
 «Plötzlich starke Zeichen» sah Münchens auflagenstärkste Boulevardzeitung Anfang Mai «in der Stadt». Und auch die anderen Feuilletons der bayerischen Metropole schütteten des Lobes volle Füllhörner über ein Ereignis aus, das im Namen Pit Kroke personifiziert ist: Überall und nie zu übersehen, vor der Feldherrnhalle, vor dem Nationaltheater und der Residenz, am Obelisk auf dem Karolinenplatz, nahe des Königsplatzes stehen sie, die Plastiken dieses bislang nicht in Erscheinung getretenen Bildhauers aus Oberbayern und Sardinien, 19 Male «in Megalo-Handschrift», wie die Abendzeitung sich verschrieb — metaphernhafte, mehr oder minder mißglückte Versuche, den öffentlichen Raum zu möblieren.
«Plötzlich starke Zeichen» sah Münchens auflagenstärkste Boulevardzeitung Anfang Mai «in der Stadt». Und auch die anderen Feuilletons der bayerischen Metropole schütteten des Lobes volle Füllhörner über ein Ereignis aus, das im Namen Pit Kroke personifiziert ist: Überall und nie zu übersehen, vor der Feldherrnhalle, vor dem Nationaltheater und der Residenz, am Obelisk auf dem Karolinenplatz, nahe des Königsplatzes stehen sie, die Plastiken dieses bislang nicht in Erscheinung getretenen Bildhauers aus Oberbayern und Sardinien, 19 Male «in Megalo-Handschrift», wie die Abendzeitung sich verschrieb — metaphernhafte, mehr oder minder mißglückte Versuche, den öffentlichen Raum zu möblieren.Damit gelang vor allen Dingen den Managern dieses Bildhauers, worum seit Jahren engagierte Fachleute in dieser Stadt, die sich gerne durch die Bevorzugung des schönen Scheins hervortut, ringen: Plätze und Orte zur Verfügung zu haben, an denen linear und konzis die Strömungen internationaler Plastik gezeigt werden können. Nach Willen der Kommunalpolitiker (und nicht nur deren) sollte Beuys nicht sein, sollte Serra nicht sein, nicht einmal in geschlossenen Räumen. Aber Pit Kroke mußte sein, auch wenn dessen Kunst nicht eben eine hohe ist.
Das hat natürlich Gründe. Und die liegen im, wie könnte es anders sein, Finanziellen — was nicht weit entfernt ist vom Provinziellen, das sich gerne dort zeigt, wo das Gute so nah ist.
Zwei professionelle, sprich am Profit orientierte Kunstvermittler hatten dieses Kroke-Paket geschnürt, indem sie mit Hilfe von Fremdenverkehrsverbänden und Industrie die komplette Ausstellung finanzierten und, quasi gegen Portokostenerstattung, den Großgemeinden München und Duisburg anboten. Dankbar griff man in der bayerischen Landeshauptstadt, in der man gerade dabei ist, die bereits genehmigten Ausbaupläne für die Städtische Galerie wieder zu kippen, zu — für 50.000 Mark. Das entspricht exakt dem Betrag, den Helmut Friedel sich für sein der jungen Kunst gewidmetes Kunstforum bei privaten Förderern holen muß.
Das Frappierendste an dieser kleinkarierten Veranstaltung ist jedoch die seltene Eintracht derer, die ansonsten bei jedem Anflug einer Provinzposse gequält aufschreien. Nahezu einhellig sang man ein Loblied auf diese Lichtschliere am Firmament Kunst im öffentlichen Raum. Selbst dann, wenn man zur Ehrenrettung des einen oder anderen Kritikers annehmen möchte, er habe nur Lob gegossen, um ein zartes, auflkeimendes Pflänzchen nicht sofort wieder eingehen zu lassen, dem sei in seine Hobbygärtner-Kladde geschrieben: Um der Qualität Platz zu schaffen, muß man das Mediokre eliminieren können.
Weltkunst 12/1990, Kunst in Kürze, S. 1894
Photographie: Mathias Bigge, Wikipedia, GNU
| So, 27.12.2009 | link | (2135) | 0 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Bildende Kunst |
Die Identifizierung der Form mit Substanz
Zur Arbeit von Rudolf Wachter — eine Einführung*
 Als ich, sehr geehrte Damen und Herren, mir vor etwa drei Wochen gemeinsam mit Rudolf Wachter dessen Ausstellung im Ulmer Stadthaus anschaute, stieß ich auf eine Überraschung. Das hatte ich, der ich seine Arbeit schon recht lange kenne, zuvor noch nie gesehen: Zeichnungen, genauer: Akte. Nach einer Weile des Betrachtens dieser ‹Akte› fiel mir spontan eine Charakterisierung dafür ein: Maserung. Und Rudolf Wachter nickte.
Als ich, sehr geehrte Damen und Herren, mir vor etwa drei Wochen gemeinsam mit Rudolf Wachter dessen Ausstellung im Ulmer Stadthaus anschaute, stieß ich auf eine Überraschung. Das hatte ich, der ich seine Arbeit schon recht lange kenne, zuvor noch nie gesehen: Zeichnungen, genauer: Akte. Nach einer Weile des Betrachtens dieser ‹Akte› fiel mir spontan eine Charakterisierung dafür ein: Maserung. Und Rudolf Wachter nickte.Ein paar Jahre ist es her, daß er alles andere als nickte, sondern sich vielmehr heftig wehrte, als ich ihm bedeutete, eigentlich sei er ein Romantiker; zumindest, er befände sich in der besten Tradition der Romantik. Da war Erklärungsbedarf notwendig. Denn meine derartige Bewertung sollte alles andere als den Zusammenhang herstellen zwischen seiner Arbeit und dem, was heute meistens dem inhaltlichen Irrtum unterworfen ist: der eben auch so genannten Romantik des abendlichen Herbstspaziergängers, der die untergehende, zwischen den Bäumen durchblitzende Sonne genießt — oder einfach nur der Romantik des Händchenhaltens bei Kerzenlicht. Damals, bei diesem langen Gespräch, waren es andere Worte, die ich gebrauchte, um mit diesem Mißverständnis auszuräumen.
Heute will ich — bei meiner Charakterisierung ‹romantisch› bleibend — darauf verweisen, daß das Wesentliche für die Romantik nicht der Inhalt ist, sondern die Form — und das mit einem dialektischen Zitat von Herbert Read untermauern: «Man könnte rasch erwidern, daß diese Unterscheidung unreal sei: die Form existiere nicht an und für sich, um sich mit irgendeiner seelischen Substanz im Schmelzzustand zu füllen — vielmehr sei sie die Kristallisierung eben dieser Substanz, sobald sie im Geiste des Dichters [hier die des Bildhauers] erkaltet. Aber wer so denkt», meint Herbert Read, «denkt bereits romantisch. Die Identifizierung von Form mit Substanz — das gerade ist die romantische Revolution.»
Diese «romantische Revolution» ist mehr als das, was Irving Babbitt ihr unterstellte und wie sie heute oftmals und wieder bezeichnet wird, nämlich «krude Gefühlsseligkeit». Künstlerische Fähigkeit ist es, um mit Schelling zu sprechen, «nicht kalte Begriffe sich anzueignen — leblose technische Regeln —, sondern lebendige und lebensschaffende Ideen, welche ihre Evidenz in sich tragen, die Gewißheit, daß sie wesentlich eins sind mit der Natur ...»
Wer nun Rudolf Wachters Identifikation der durch die Natur vorgegebenen Form mit Substanz partout in ein negativ-zeitgeistiges, Geschichte bzw. Kunstgeschichte permanent ignorierendes ‹Denk›-Repertoire überführen möchte, der soll ihn eben, wie so oft geschehen, weiterhin als ‹ökologischen› Künstler bezeichnen. Von Sachverstand zeugt es jedenfalls nicht. Vielmehr ist es so, wie Hans Gercke in einem Katalogtext zur Arbeit von Rudolf Wachter geschrieben hat: «Wer Wachters Arbeiten genauer betrachtet, wird [...] feststellen, daß sie alles andere als expressive Illustrationen oder anklagende Hinweise auf die Verletzungen, die der Mensch der Natur und damit sich selbst und seinesgleichen zufügt. Es geht vielmehr», so Gercke weiter, «um eine Balance zwischen dem Gewachsenen und dem Gemachten, zwischen Vorhandenem und vom Menschen verantwortender Veränderung, um eine Art Dialog also, die aktuell und notwendig ist ...»
Des Künstlers Rudolf Wachter Material ist das Holz — so wie der andere Künstler mit anderen Materialien arbeitet — etwa Metall oder Stein —; auch damit hat er früher gearbeitet.
Mit dem Holz ist er sozusagen zu seinen Wurzeln zurückgekehrt — er hat bei seinem Vater eine Schreinerlehre gemacht. Das ist aber auch das einzig scheinbar Mythische daran. Das, was er früher mit dem Holz gemacht hat, hat mit den Arbeitsvorgängen von heute nichts, aber auch gar nichts mehr gemein. Im Gegenteil, vielleicht mit Picasso gesagt, der einmal, angesichts von Kinderzeichnungen und ihren abstrahierenden Linienführungen, geäußert hat: Und dazu habe ich dreißig Jahre gebraucht!
Rudolf Wachter arbeitet nicht die Natur nach, er arbeitet mit ihr. Und — das ist wesentlich — sein Repertoire entstammt der Moderne und deren (ganzheitlichen) Ausformungen! Er füllt, wie eingangs gesagt, die Form mit Inhalt, also mit seinen künstlerischen Überlegungen — er beatmet sie mit seinen Ideen. Wer nicht genau hinschaut oder nur Photographien von seinen Skulpturen sieht — mir ging das vor Jahren so —, meint aneinandergefügte kubische Teile zu erkennen. Wir wissen, daß dem nicht so ist. Rudolf Wachter arbeitet — immer mit der Kettensäge — sozusagen die Konstruktion der Natur, die Gewachsenheit eines Stammes, einer Astgabelung nach und läßt so, vermittels seiner Vorberechnung, jene originäre Kunst entstehen, die ihn seit Jahren zum ewig jungen ‹Geheimtip› macht.
Nach vielen Skulpturen — nach Eduard Trier nimmt der Bildhauer vom Material weg und schafft so die ‹Skulptur›, während der Plastiker mit ihm aufbaut und so die ‹Plastik› erarbeitet —, nach all den Jahren ist Rudolf Wachter wieder zu einer Arbeit zurückgekehrt, die wieder auf eine dem Konstruktivistischen entlehnten Formensprache zurückführt: die hier zu sehende Skulptur ‹Tisch für ein Kunstgespräch – oder die Kunst, aneinander vorbeizureden›. Sie ist nach den selben, zuvor von mir angesprochenen Kriterien angefertigt worden. (Auskünfte über Einzelheiten erteilt Ihnen Rudolf Wachter sicherlich gerne im Anschluß.) Dieser Titel, vor allem der Untertitel, eben ‹oder die Kunst, aneinander vorbeizureden›, hat sicherlich seinen Ursprung im Werdegang Rudolf Wachters, also und eben auch in der eben immer mehr zunehmenden ‹Bereitschaft› der Menschen, an dem, was ihnen gezeigt wird, vorbeizuschauen — vorbeizureden. Dieser für Rudolf Wachter ungewohnt literarische Titel klingt für mich persönlich wie ein tiefer, knorziger, allgäuischer Seufzer, den ich mit einem Bild von Herbert Read unterstreichen bzw. bestätigen möchte:
Petrarca war — neben seiner Dichtung — bekannt «dafür, daß er der erste war, der einen Berg bestieg, um die Aussicht zu genießen. aber als er den Gipfel des Mont Ventoux erklommen hatte, erinnerte er sich an die Stelle aus den Konfessionen des heiligen Augustin — an eine Stelle, die sagt, daß ‹Menschen weit gehen, um die Höhe des Gebirges, die stolzen Wogen der See, die langen Flußläufe, die weite Fläche des Ozeans und die Kreisbahn der Sterne zu bewundern›; und Augustin läßt sich aus über die Wunder des Gedächtnisses und der Vorstellungskraft. Er erörtert sogar die allein dem Menschen eigene Fähigkeit des Denkens, die er definiert als die Zusammenziehung diffuser und erdrückter Erinnerungen; und es scheint nahezuliegen, daß Descartes an diese Stelle dachte, als er seinen berühmten Grundsatz formulierte.» Und der lautete bekanntlich:
Ich denke, also bin ich.
*Einführung Rudolf Wachter, 1. September 1994, 19.00 Uhr, marquardt-ausstellungen, München
Innerhalb der Rede gab es teilweise Abweichungen vom Manuskript.
Ivo Kranzfelder hat sich ausführlichere Gedanken über die Arbeit von Rudolf Wachter gemacht: Kunst und Naturerkenntnis
Photographie: Andreas Präfcke (vergrößern), GFDL and Creative Commons CC-BY 3.0
| Mo, 21.12.2009 | link | (3077) | 0 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Bildende Kunst |
Vom Stempel zum Pixel
Die Welt verstehen wollen
Über Michael Badura
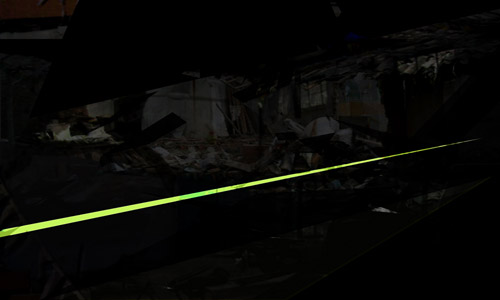
«Ja, Künstler nennt Ihr mich, weil ich nur künstele. Weil ich nur so tun soll als ob, weil ich nur so tun kann als ob. Ihr tut so, als ob Ihr meine Arbeit schätzt, weil Ihr glaubt, daß sie nichts mit den tatsächlichen Realitäten zu tun habe. So haltet Ihr mich hinter vorgehaltener Hand für einen lustig-bizarren Spinner. So soll ich sein: Ein Häufchen Seele, ein tanzendes Irrlicht, ein buntschillerndes Bläschen, ein weltfremder Tropf.»1
So in etwa könnte Michael Badura sich auch im Januar 2007 geäußert haben, in seinem Haus im Bergischen Land am Rand von Wuppertal, wo er an der Universität Kunst gelehrt hat. Denn auch wenn diese Schimpftirade weit über 20 Jahre zurückliegt, so spiegelt sie nach wie vor sein Denken, sein Tun. Möglicherweise ließe der bald Siebzigjährige (2008) es heute etwas (alters)weiser angehen, doch inhaltlich hat sich nichts an dem geändert, über das er 1984 gewettert hat: «Doch wehe, ich mische mich ein, in Eure Realitäten. Wehe, ich berühre die Gleichgültigkeit und die Solidarität der (Geld-)Macher und Sortierer, der Verwalter und Vollstrecker. [...] So habe ich zu bleiben: Ein manischer Schweber ohne Bodenhaftung, ein herumirrender Derwisch.»2
Die fehlende Bodenhaftung hat man ihm in den sechziger und siebziger, aber auch noch in späteren Jahren vorgehalten. Und wenn das heutzutage nicht mehr so lautstark geschieht, dann dürfte es daran liegen, daß Michael Badura keine Schlagzeilen mehr produziert, sondern abseits des Rummels arbeitet. Still, jedoch keineswegs ‹zurückgezogen›, tut er das, was er immer tat und weiterhin tun wird: künstlerisch die Welt ergründen. Doch diese Welt ist nicht etwa eine andere als die unsere, schon gar kein Mikrokosmos, der eine künstlerische Erdachsenverschiebung erfahren hat. Sie ist allerdings auch nicht diejenige, die nach ökonomischen Wertungen aufgeteilt worden ist in erste, zweite und dritte und vierte Welt oder gar in Länder an Schwellen — zur Weltmarkt-Glückseligkeit. Die Freuden der globalisierten Ökonomie tragen nicht unbedingt zu Baduras Hochgefühl bei. Diesem Bodenständigen ist eher am Erhalt dessen gelegen, in dem wir leben, rubriziert vielleicht unter Ökologie; jenem Begriff, der vermutlich bald so plattgetreten sein wird wie der der Esoterik.3 Ökologie bedeutete ursprünglich nichts anderes als die Lehre vom Haus-Halt(en).4
Mit dieser Art des Haushaltens hat sich Michael Badura von jeher beschäftigt. Und zwar lange, bevor so manch eine Vorfeld-Grüne oder ihr männliches Pendant das Wort Ökologie etymologisch bzw. präparlamentarisch überhaupt gehäkelt bekamen. Bereits 1964 entwickelte Badura ein ‹ökologisches› Laboratorium, in dem künstlerisch ‹forschend› eine ‹Versuchsanordnung› «‹aller› puren Natursubstanzen und -verbindungen sowie ‹aller› denkbaren Vermischungen, Verschmutzungen, Vergiftungen durch chemische und widernatürliche Stoffe und Verbindungen»5 angelegt wurde. Die Eingeweckte Welt wurde im Februar 1967 erstmals in der Göttinger Galerie im Center gezeigt. Dazu schrieb Badura eine fiktive Reportage6, in der die bereits deutlich erkennbare, «unumkehrbare»7 Umweltzerstörung beschrieben war. 1967, das war das Jahr, als man in Paris, Berlin und anderswo sich anschickte, intensiver als zuvor das Jahr vorzubereiten, in dessen Folgezeit sich außerordentliche gesellschaftliche Veränderungen ergeben und das als das Geburtsjahr der 68er in die Annalen eingehen sollte. Die dem Rot der Außerparlamentarischen Opposition, bekannter unter dem Kürzel APO, nachfolgende Farbe Grün sollte als Hoffnungssymbol noch lange dem Poesiealbum vorbehalten sein. Michael Badura hatte die Hoffnung allerdings bereits fahren lassen. Schon 1966 war er ausgewandert:
«Ich bin auf dem Mond geboren. Es ist nicht lange her, da verließen meine Vorfahren und mit ihnen viele andere Menschen die Erde, weil sie ihnen anfing unbewohnbar zu werden.
Hier auf unserer Mond-Erde sind wir mittlerweile über alle existentiellen Schwierigkeiten hinweg, und es gibt für uns kaum noch Probleme — es sei denn, wir erfänden uns welche zum Zeitvertreib.»8
Das Haus der deutsch-japanischen Familie Badura im Bergischen Land: Das Thema Natur bedarf keiner weiteren Erwähnung. Es ist sichtbar. Das 4.000 Quadratmeter große, terrassenförmig angelegte Hanggrundstück klärt auf: Hier wird alles zugelassen, durchaus auch eine gewisse ‹Reglementierung› von Natur. Hier gehört jede Pflanze, jedes Tier, ob einheimisch oder eingewandert, zur zu verstehenden Welt.
Es gilt jedoch, Mißverständnisse zu vermeiden. Durch dieses Haus schlurft niemand birkenstockartig. Es wird diskutiert, bisweilen gestritten. Es geht ebenfalls um tagesaktuelle Politik. Badura empfindet sich vom Ansatz her «eigentlich» als Anarchist. Wenn auch alles andere als ein schwarz gewandteter Steinewerfer, sondern sehr vielmehr einer im ursprünglichen, im späten 18. Jahrhundert entstandenen Sinn des Begriffes: der herrschaftlosen, gleichberechtigten, aber immer gewaltfreien Gesellschaft.9 Michael Badura wäre, lebte er nicht in der Jetztzeit, durchaus dem Umfeld eines Diderot, eines d'Alembert, eines Voltaire zuzuordnen, den französischen Enzyklopädisten, die sich Mitte des 18. Jahrhunderts der Aufklärung verschrieben hatten.10
Diese Aufklärer haben quasi die Sprache der biblia pauperum, der Armenbibel umgekehrt, die mit bestimmt war für diejenigen, die nicht lesen können. Sie haben die Bilder übersetzt in Sprache — die für immer mehr Menschen langsam zugänglich geworden war. Badura kehrt es quasi um bzw. bezieht sich auf seine (künstlerische) Kraft des Sichtbarmachens. Nachdem immer weniger Menschen die Sprache beherrschen und immer mehr Bilder gucken, bedient er sie. Er kehrt den zunehmenden Analphabetismus des tumben, unreflektierten Bildkonsums um zugunsten des genaueren Hinschauens. Anders, als weiland Diderot ff. das Bild in Sprache übertragen haben, setzt er nun als Fährmann das Bild über ans Ufer des Unterscheidungsvermögens.
Michael Badura ist Konzept-Künstler, jedoch nicht «so akademisch wie Klaus Honnef», nicht im Sinne der US-amerikanischen Concept Art. Lange bevor die Concept Art als künstlerischer Stil begriffen worden war, hat es «sehr viele Bestrebungen bei Künstlern [gegeben], sich konzeptuell auszudrücken gegenüber einer akademischen, traditionellen Kunstausübung». — «Weil man gemerkt hat», so Badura weiter, «daß das Gedankliche, Ideenmäßige zu kurz kam zugunsten traditioneller Bildtechniken.»
Hier setzt die Kunst von Badura an, in Umsetzung einer disziplinüberschreitenden Methode, genauer: dem des Versuches, die Welt als Gesamtes zu verstehen, indem er sie — nicht als Forscher und auch nicht als Philosoph! — untersucht. Das geschieht: «Indem man sich mit ganz bestimmten Aspekten gezielt beschäftigt, man versucht, sie [die Welt] vor sich hinzustellen. Sich etwas vorzustellen, ist ja eigentlich das künstlerische Prinzip. Ich stelle etwas vor mich hin, um es erst richtig sehen zu können, das heißt, ich trenne es, ich löse es aus dem Gesamtzusammenhang, um es besser betrachten zu können.» Wir kennen das vom Betrachten einer Skulptur oder Plastik: nur das Herumgehen um diese ermöglicht uns den Blick auf Einzelheiten. Oder anders, die Kindheitserinnerung: Wir haben bisweilen das an der Wand hängende Bild angehoben, um zu erkunden, ob sich ‹etwas› dahinter befindet. Dieses Erkennen, Finden ist es, das Badura antreibt.
Des Findens, zunächst einmal des ‹Geheimnisvollen› oder auch des ‹Reichtums› wegen, deshalb lief Badura als Junge im oberfränkischen Fichtelgebirge11 durch den Wald, klopfte mit dem Hammer Steine auf, «weil ich der naiven Hoffnung war, ich könnte irgendwann eine Goldader oder eine Silberader» entdecken. Später wollte er Ornithologe werden. Dann hat er alles — Gefieder, Bäume, Flüsse, Landschaften — «abgemalt». Wieder aufgenommen hat er diese kindliche Tätigkeit dann als wissenschaftlicher Zeichner im Alter von 23 Jahren (als Gastdozent) an der Kasseler Werkunstschule. Das setzte sich fort an der Göttinger Universität. Die dort bis 1973 produzierten Lehrtafeln — Amöben bis hin zu ‹höheren› Tieren — hängen noch dort bzw. sind archiviert. Und nachdem ihn das zu «langweilen» begann, wechselte er zu den botanischen, den zoologischen Instituten. Daraus ergab sich: «Mein Zimmer befand sich zwischen den ganzen naturhistorischen Präparaten, so daß ich von daher ganz selbstverständlich auf die Arbeit der Eingeweckten Welt gekommen bin, indem ich dann die ganze Welt speichern wollte, so ähnlich, wie sich das ja eigentlich in einem naturwissenschaftlichen Museum auch zeigt.» Über diese Eingeweckte Welt schreibt Michael Fehr:
«[...] eine wirkliche Versuchsanordnung, in der Badura anfangs in fünfzig, später in über hundert Gläsern verschiedene Stoffe konkret miteinander reagieren läßt — und damit ein realistisches Bild unseres Umgangs mit der Natur entwickelt, das sich nur noch im Maßstab von unserem realen Operieren in der Welt unterscheidet. Zum anderen ist die Eingeweckte Welt aber eine Fiktion; die Geschichte eines auf dem Mond Geborenen, den seine Neugierde zur Erde treibt, um dort die Verschmutzung und Vergiftung zu studieren, wegen der seine Vorfahren die Erde verließen; eine Fiktion, die realistisch gemacht wird durch die konkreten biochemischen Reaktionen in den Einmachgläsern; die aber ihrerseits wieder fiktionalisiert werden über Beschreibungen und Geschichten, die Badura dem Geschehen in den einzelnen Gläsern zuordnet.»12
Die Initialisierung des baduraschen künstlerischen Forscherdrangs fand statt, als ihm 1963 im südniedersächsischen Barlissen die Bauern erzählt hatten, ihre Kühe könnten das Wasser aus dem Flüßchen Dramme nicht mehr trinken. Die Gründe dafür lagen in der Verseuchung durch Tetrachlorkohlenstoff, damals Bestandteil von Schädlingsbekämpfungsmitteln. Und als sich schließlich die daraufhin angesprochenen Wissenschaftler außerstande sahen, dagegen etwas zu unternehmen und sich stiekum wieder ihren alltagsabgewandten Studien zuwandten, thematisierte Badura auch diese Problematik. — «Wir fühlen», schrieb Ludwig Wittgenstein, «daß selbst wenn alle möglichen wissenschaftlichen Fragen beantwortet sind, unsere Lebensprobleme noch gar nicht berührt sind.»13
Doch auch an diesem Punkt gilt es, Mißverständnissen die Nahrung zu nehmen. Badura ist kein verhinderter Naturwissenschaftler. Der ist für ihn jemand, «der im Zerkleinern der Welt einen Selbstzweck sieht. Man kann viele Erkenntnisse nur gewinnen, indem man eine Sache kaputt macht. Ich versuche, die Sache intakt wahrzunehmen. Das Verstehen [von Welt] heißt eigentlich, ein friedliches Ansehen wahrnehmen, im Gegensatz zu der Erkenntnis, die durch Zerstörungszwecke kommt, wie das bei Naturwissenschaften häufig der Fall ist.»
Schon Schopenhauer meinte: Die Welt als Vorstellung, sofern sie dem Ursachen- bzw. Endprinzip unterworfen sei, sei Objekt der Wissenschaften, im anderen Fall Gegenstand der Kunst.14 Damit räumte er mit Hegels Idealismus-Anspruch auf. Gott, Paradies, Wahrheit waren dahin. Wie später bei Michael Badura. Der ist eher der Wirklichkeit zugeneigt. Für ihn, sagte er, sei entscheidend, «daß ein Künstler eigentlich ein Realist sein sollte, im Sinne von Leonardo da Vinci, im Sinne eines möglichst totalen Verständnisses als Ausgangspunkt von allem». Der Vergleich mit da Vinci entspringt keiner obsessiven Eigenein- oder gar Überschätzung von Genialität. Badura bezieht sich in diesem Zusammenhang schicht auf das zu Entdeckende, das (Er-)Finden. (Farbdossiers Freunde, Bekannte und Arschlöcher, 1977 – 1980)
Im Jahr von Big Brother, von George Orwells Buch 198415 hatte Badura im Wuppertaler Von der Heydt-Museum die Ausstellung Büro eingerichtet, deren Konzeption 1977 einsetzte: «Ein Ort, an dem Menschen zu Akten und das Leben zu bürokratischem Unrat dahinwest. [...] Der Einzelne in der Mühle unwürdiger Systeme, in der Mühle objektiver Zerkleinerung. [...] Nicht unbedingt immer als Ausdruck sadistischer Böswilligkeit, sondern oft schlicht nur als Ausdruck von Phantasielosigkeit und lähmender Unfähigkeit an sich, die jeweilige Wirklichkeit in den Griff zu nehmen.»16
Er hatte den ‹Großen Bruder› während eines Spaziergangs in der Auslage eines Fachbetriebs für Bürotechnik entdeckt. Nicht ihn persönlich, sondern, wie Badura erzählt, dessen Werkzeug, seinen «langen Arm und den langen Atem». Commodore war der Name des ersten Rechners, der zur privaten Nutzung auf den Markt gekommen war, und kein «Zweifel, der Computer war das ersehnte Werkzeug für die Bürokratie an sich und die Mächte dahinter, auch wenn es zunächst nur wie ein abseitiges Spielzeug daherkam».17
Als die Allgemeinheit etwa ab 1990 begann, mit Computern zu arbeiten, erhielt sie meist bereits entsprechende Software mitgeliefert — auf daß diese Rechner (zunächst einmal) wenigstens als ‹verlängerte Schreibmaschine› zu nutzen waren. Doch als Michael Badura 1984 seinen Commodore kaufte, ging zunächst einmal gar nichts. Sogar seine vielen, seine Kunst begleitenden Texte mußte er seinerzeit nach wie vor in die gute alte Reise-Olympia tippen. Dennoch war der lediglich auf 0+1 basierende Rechner das adäquate Werkzeug. Man mußte lediglich damit umzugehen lernen. Und so begann Badura sich in die Technik des Programmierens einzuarbeiten. Die ersten Ergebnisse, Eins und Null digital zusammenzuzählen, waren allerdings verblüffend.
Denn es sollte sich bald zeigen, wie ausgeprägt Michael Badura digtitale Zeichen zeichnerisch bereits vorweggenommen hatte. In Alexanderschlacht aus dem Jahr 1958 wird das bereits erkennbar. Es setzt sich fort in Organisationen mit Schwerkraft aus den Jahren 1962 bis 1964.
Und auch die Stempelbilder verweisen bereits auf die Pixel, mit denen Badura ab 1984 arbeiten würde: Mit winzigen Quadraten überstempelte er er alte Meister, Skulpturen von Auguste Rodin oder Gemälde von Caspar David Friedrich. Im Vordergrund stand dabei das Erzeugen gleichförmiger Maße, die auch in der Masse identisch blieben. Eben die ‹Die Verkleinerung des Lebens›, die Reduktion auf das Kleinstmögliche.
«Das digitale Prinzip», so Badura, «ist ein Treppenprinzip, vergleichbar dem Schiffchenversenken, also von gleichen Teilen, die [...] senkrecht, waagerecht, endlos aneinandergereiht sind, im Gegensatz zur organischen Form. Das ist auch eigentlich der Punkt, wo die Geister sich tatsächlich unterscheiden und wo auch Feindschaften entstehen.» Denn die Welt würde «vereckt». Durch die Digitalisierung würden (organische) Rundungen vermieden bzw. ausgeschlossen. Badura nennt solche Abläufe gar einen «Brutalisierungsprozeß, der mit der Digitalisierung anfangs visuell verbunden war».
Auf die Babylonier hebt Badura dabei ab. Babylonien: Sumerer, Amurriter, Hurriter oder Kassiten. Sie waren es, die in der Zeit zwischen 3500 und 1000 vor Beginn unserer Zeitrechnung in Mesopotamien nicht nur für die vielzitierte verbale Verwirrung sorgten, die heute noch gerne als ‹Anmaßung des Menschlichen› herbeizitiert wird: der Turm zu Babel.18 Doch sie, allen voran die Sumerer19, schufen eine Zivilisation, deren Errungenschaften noch heute die Basis der unseren bilden, bespielsweise: Astronomie, Keilschrift, Mathematik oder das Rad. Dazu gehörte eine Städteplanung, eine Architektur, die ihresgleichen suchte. Man versuchte seinerzeit, mittels geometrisch angelegter Architektur eine wilde, unbezähmbare Natur zu beherrschen, sie zu begrenzen, durch Mauern, Wälle oder Zäune. Hier zeichnet sich bereits die Einengung des Natürlichen ab, das wir gerne Ausufern nennen. Aber auch verschiedene Rechen- oder Zahlensysteme verweisen auf eine spätere ‹Digitalisierung›.20
Der Beginn Baduras «digitaler Einlassung» war «eigentlich» ein kritischer, weil ihm «sofort bewußt wurde, daß das eine unglaubliche Macht darstellen wird eines Tages, und vor allen Dingen große Einschnitte im Sozialgefüge der Menschheit [...] entstehen [...], daß viele Menschen ‹freigesetzt›21 werden [...], daß viele Prozesse automatisiert werden.»
Die aus dem Ruder laufende Macht der Automatisierung deutete ‹unterhaltend› beispielsweise Charlie Chaplin 1936 in seinem Film Modern Times an, in dem ein Wanderarbeiter in die Maschinerie neuester Technik gerät. Wer weiß, was Chaplin aus der (späteren) Erkenntnis um den Computer gemacht hätte. Gezeigt hätte er möglicherweise die multiplizierte ‹Figur› Mensch.
Michael Badura hat sie (sich) geschaffen — für seinen (künstlerischen) Umgang mit der Natur und deren Wissenschaften bzw. deren Gewese darum: den Klon.22 Auch hierbei tritt wieder 1984 auf den Plan: das Streben nach dem Lebewesen, das vollständig zu unterwerfen ist. «Der Klon als Arbeiter, als Steuerzahler und als Rentenlieferant wäre eine — naive — Vorstellung, wie man jetzt hier der Menschheit helfen könnte.»
Doch um diesen übelsten Fall eines ‹Nach›-Denkens über orwellsche Schreckensbilder geht es ihm nicht tatsächlich. Auch nicht um vorstellbare künstlerisch «dienstbare Geister, ähnlich den Zauberwesen bei Goethe, die irgendwelche Dienste einem erweisen und weitgehend autonom, also frei von menschlichem Einfluß sind».23 Entscheidend war, «daß für mich immer schon interessant gewesen ist, mit den gleichen Methoden zu arbeiten wie die Wissenschaft. Das heißt, ich wollte selber für mich erst einmal herausfinden, inwiefern man mit dem Computer, also mit einem künstlichen Mittel, eine möglichst identische, menschliche Gestalt produzieren kann.»
Wir betrachten erstaunt Höhlenmalereien, sehen uns gerne antike Mosaiken an, prüfen den Goldenen Schnitt bei Raffael oder Tizian, stehen verblüfft vor Caravaggios oder Rembrandts Hell-Dunkel-Malereien, schwärmen vom Übergang des Impressionismus in den Expressionismus, diskutieren über Öl- bzw. Acrylfarben, über Farbauftrag auf grundierten oder nichtgrundierten Leinwänden sowie photographischen oder Video-Techniken in Installationen24. In der Geschichte der Kunst ist immer heftig über Neuerungen debattiert worden. Doch dem Computer steht die Branche nach wie vor höchst skeptisch gegenüber — obwohl er auch aus der Kunst kaum noch wegzudenken ist.
Badura hat lange mit herkömmlichen Mitteln gezeichnet, gemalt, sich, teilweise so manches Konzept vorwegnehmend25, mit Farbe auseinandergesetzt, etwa in den Farb-Dossiers oder seinen Wunschvorstellungen zur Bundeskunsthalle, 1978/79.
Geradezu konterkariert hat er sie als «perfekt geschlossenes System» in Büro für Orwells 1984. Er hat Objekte gestaltet, mit Draht, Teer, Zement, mit Materialien aus der Natur in der Natur, aber auch im Raum Installationen erstellt, mit Photographie gearbeitet.
All diese Sujets sind nach wie vor in seiner Arbeit sichtbar. Nur daß er sich eben nach 1984 ausschließlich der Computertechnik als künstlerischem Ausdrucksmittel bedient hat. Sie ist ihm eben das, was anderen Leinwand, Pinsel und Palette bedeuten.
«Der Computer», so Michael Badura, «wird einen Siegesmarsch antreten, nicht nur durch einzelne Nationen, sondern er wird international überall sich als das entscheidende Instrument herausstellen [...]. Und die andere Sache ist, daß für mich ein Künstler eigentlich ein Realist sein sollte [...] im Sinne eines möglichst totalen Verständnisses als Ausgangspunkt von allem. Und wenn Künstler den Computer nicht verstehen, würde ich ihnen heute auch absprechen, daß sie die Chance hätten, die Welt zu verstehen. Und wenn ein Künstler nicht mehr die Welt versteht, kann er eigentlich für mich kein Künstler mehr sein, sondern er wird dann automatisch zur Folklore. [...] Wenn zum Beispiel ein Maler ein Sonnenblumenblatt malt, muß er gar nichts von der Sonnenblume verstehen. Wenn er aber anfängt, mit dem Computer ein Sonnenblumenblatt nachzubauen, wird er auf einmal merken, er muß sich mit der Sonnenblume beschäftigen.»
Und damit mit der Welt.
Anmerkungen
1 Aus: Die Verkleinerung des Lebens. Für Konrad Zuse und den Rest der Welt. Wuppertal, 4. 4. 1984, veröffentlicht in: Andreas Seltzer/Katharina Meldner (Hrsg.), KÜNSTLERPECH/KÜNSTLERGLÜCK, 3 Galerie Friedrichstrasse, Berlin 1985, Talwerkarchiv; hier zitiert nach: Badura-Museum.
2 a. a. O.
3 Esoterik ist abgeleitet vom griechischen esotoros und bedeutet das Verborgene, Innere; ursprünglich: Geheimwissen für Eingeweihte (Orden, Logen). Es fand zunächst als Gegenbewegung zur Aufklärung Verbreitung, die sich, vor allem in der Person Voltaires, in erster Linie gegen die Politik der katholischen Kirche und den ihr anhängenden Adel richtete, dann verstärkt nach der französischen Revolution, als weite Teile der verunsicherten Bevölkerung sich einer verdrängenden, ins Innere zurückziehenden Romantik zuwandten. Doch heutzutage kommt Esoterik eher als kostenpflichtiges Nicht-Wissen daher.
4 Ebenfalls aus dem Griechischen: oikos = Haus, logos = Wissenschaft, also die Lehre von der Haus-Wirtschaft, wobei auch die Umgebung des Hauses gemeint ist.
Doch es ist Florian Felix Weyh zuzustimmen, der diese Definition für einen «archaischen Begriff von Ökonomie» hält (eMail vom 2. März 2007 an den Autor). Das verweist, passend zu Geiz-ist-geil, auf ein neuerliches deutsches (Gesellschafts-)Phänomen: Bio. Bio-Äpfel aus Chile? Hauptsache gesund. Und billig. Egal, was es (die Welt) kostet.
5 Michael Badura: Die Verkleinerung des Lebens, a. a. O.
6 Michael Badura: Ich bin auf dem Mond geboren ..., in: Die Eingeweckte Welt. Das Totale System. Eine Projektion. Verfaßt 1966, nachzulesen in Baduras virtuellem Museum.
7 Soweit nichts anders gekennzeichnet, entstammen die Zitate aus Gesprächen, die der Autor und der Künstler zwischen dem 9. und dem 11. Januar 2007 in Baduras Haus geführt haben. Dank an Michelle Westedt fürs Protokollieren.
8 Ich bin auf dem Mond geboren ..., a. a. O.
9 Die Anarchie nahm ihren Anfang eigentlich ja bereits bei Homer oder Herodet, bei denen es sich noch um ‹führerlose› Menschen handelte. Bei Aristoteles waren es die Sklaven ohne Herrschaft. Kant, Schlegel und viele andere danach wie Stirner haben jedoch den Weg aufgezeigt: Anarchie sei Herrschaftslosigkeit, allerdings ohne Gewalt. Also alles andere als das, was vermummte Rabauken darunter verstehen.
10 Die zwischen 1751 bis 1772 erschienene 28bändige Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, gemeinhin bekannt als das Werk von Denis Diderot, gilt als das grundlegende Werk der französischen Aufklärung. Es hatte entscheidende geistige Einflüsse auf die europäische, letztendlich die Geschichte der westlichen, ‹zivilisierten› Welt; wo es im Deutschen ‹Kultur› heißt, wird es im Französischen ‹Civilisation› genannt.
11 Dorthin hatte es Mutter Badura — deren Mann im Krieg geblieben war — völlig mittellos mit ihren drei Söhnen hin vertrieben.
12 Michael Fehr: Michael Badura. Konkreter Realismus, in: ders: Badura-Werkverzeichnis, Nürnberg 1992; dieser Aufsatz analysiert Baduras Arbeit als «Künstler-Forscher mit ausgesprochen experimentellen Interessen» vortrefflich. Siehe dazu auch Baduras Texte.
13 Ludwig Wittgenstein (1889 – 1951), Tractatus logico-philosophicus. Philiosophische Untersuchungen. Leipzig 1990
14 Arthur Schopenhauer (1788 – 1860): Die Welt als Wille und Vorstellung, Zürich 1988 [F. A. Brockhaus 1859]
15 Originaltitel Nineteen Eighty-Four, erschienen 1949, deutsch 1950 als 1984. Der Titel entstand durch die Umkehrung der Jahreszahl 1948, dem Jahr, in dem George Orwell (eigentlich Eric Arthur Blair, 1903 – 1950) das Manuskript zu dieser düsteren, beklemmenden Vision eines totalitären Überwachungsstaates zu verfassen begonnen hatte, der nur mit den Mitteln einer extrem ausgeprägten Bürokratie funktionieren konnte. Ein erhellender Text von S. Andrew zur Entstehung von 1984 bzw. dessen Hintergründe ist hier nachzulesen.
16 Michael Badura in einer eMail vom 22. Januar 2007 an den Autor
17 a. a. O.
18 Das biblische «babylonische Sprachengewirr» als Vergeltung Gottes für den Hochmut der Turmbauer hat es jedoch nicht gegeben. Der Ortsname Babel wurde aus dem hebräischen balal (= verwirren) erklärt. Doch der Name entstammt einer unbekannten Urbevölkerung. Siehe: Ursula Muscheler: Die Nutzlosigkeit des Eiffelturms. Eine etwas andere Architekturgeschichte. München 2005
19 Die Sumerer sind das älteste nichtsemitische Volk aus dem südlichen Babylonien, gelegen zwischen Euphrat und Tigris, das in etwa dem heutigen Irak entspricht.
Die Bezeichnung Sumerer (auch Sumer oder Schumer) ist akkadischer Herkunft, sie bedeutet ‹Kulturland›. — Den Sumerern haben wir auch die älteste Vorstellung von Paradies zu verdanken: ewig grüne und fruchtbare Felder und Gärten. Allerdings dürfte es in diesem vor-biblschen Garten Eden keine Äpfel gegeben haben. Es dürften Feigen gewesen sein, die den Sündenfall ausgelöst haben.
20 Der Begriff ‹digital› ist dem Englischen entlehnt (digit = Ziffer) und leitet sich vom lateinischen digitus = Finger ab. «Um zu addieren und oder zu teilen, nahmen die Römer entweder ‹Rechenbretter› mit kleinen Steinchen oder einfach die Finger zur Hilfe. [...] Alles, was digital ist, basiert auf einem mathematischen System, das Leibniz 1679 erfand, eine mathematische Sprache, die auch Maschinen verstehen. Das binäre System, auch duales oder dyadisches genannt, besteht nur aus den Ziffern 1 und 0.» Zitiert nach: Hilmar Schmundt, in: Die Macht der Zahlen. morgenwelt. magazin für wissenschaft und kultur.
21 wie (Massen-)Entlassungen heute beschönigend genannt werden
22 griechisch: klon = Schößling; eine genetisch identische Kopie eines Organismus'. Bei Pflanzen, Bakterien und einigen niedrigen Tierarten kommen Klone in der Natur über die ‹Parthenogenese› vor, bei Menschen und Säugetieren mit sexueller Fortpflanzung entstehen sie auf natürliche Weise nur in Ausnahmefällen bei der Geburt eineiiger Mehrlinge.
23 Damit spricht Badura international bekanntes deutsches Bildungsgut an: «Herr und Meister, hör' mich rufen! –/Ach, da kommt der Meister!/Herr, die Not ist groß!/Die ich rief, die Geister,/Werd ich nun nicht los.» Johannn Wolfgang von Goethe, Der Zauberlehrling. Zitiert nach: Werke. Hamburger Ausgabe in 14 Bänden, Bd. 1, Gedichte und Epen. München 1977. Goethe bediente sich dabei der Vorlage des griechischen Dichters Lukian (120 – 180 n. u. Z.).
24 ein Begriff, den wir vor noch gar nicht so langer Zeit im Handwerker-Branchenbuch gesucht haben
25 Laut Michael Fehr nahm er z. B. den «radikalisierten Expressionismus, die Diskussion um die gestische Malerei der ‹Neuen Wilden› vorweg». Fehr: Michael Badura. Konkreter Realismus, a. a. O.
Künstler — Kritisches Lexikon der Gegenwartskunst, Ausgabe 78, Heft 8, 2. Quartal, München 2007
© Für den Text: Detlef Bluemler und Zeitverlag (ehemals WB-Verlag);
für die Badura-Abbildungen: © Michael Badura
| Sa, 12.12.2009 | link | (2484) | 0 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Bildende Kunst |
Die Wahrnehmung des Besonderen im Alltäglichen
Über Maik und Dirk Löbbert
«Rätselhaft ist nicht erst das Unsichtbare, sondern schon das Sichtbare»1, so paraphrasierte Bernhard Waldenfels Paul Klee, der in der Kunst — nicht in der Wirklichkeit — das Sichtbarmachende entdeckte: sinnliche Wahrnehmung, griechisch Aisthesis. Diese antike (Grund?-)Erfahrung des Menschen bestimmt bis heute dessen Verhältnis zur Welt (oder auch nicht).

Für Maik und Dirk Löbbert ist dies das logische, zentrale Thema. Die Wahrnehmung der Umwelt, die Beziehung zwischen Wahrnehmen und Erkennen et vice versa, genauer: des Umfeldes, war, lange vor den (Er-)Kenntnissen der Politiker, Aufgabe der Künstler.
Im Mittelpunkt der Arbeit von Maik und Dirk Löbbert steht das Alltägliche und Unauffällige, das insofern eine ungewohnte Aufmerksamkeit erfährt, als es vom Betrachter mit des Künstlers Auge zu sehen, zu erkennen ist: das ob seiner logischen Schlichtheit Frappierende. Die Brüder Löbbert betreiben sozusagen Behindertenhilfe, indem sie durch ihre Setzung von Zeichen den vom Sinn Überreizten, quasi den Blindgewordenen das Sehen, wenn nicht überhaupt, so doch neu lehren. Nicht nur sichtbar zu machen, ist die Intention der Brüder Löbbert, sondern auch sehend.2
Die Auseinandersetzung der Löbberts mit dem Ort, an dem sie ausstellen und/oder vorübergehend leben, ist das Hauptelement ihrer Arbeit. Ihre Wahrnehmung, das bewußte Sehen, Erkennen und Erfassen der Situation bilden das künstlerisch-intellektuelle Zentrum. Hinein spielt deshalb immer auch die Geschichte des jeweiligen Ortes; Geschichte ist kulturelle Entwicklung, also Kulturgeschichte. Aber auch jede Raumauffassung, -gliederung bzw. -orientierung bedingt das philosophische «innere Eingehen auf die um uns aufgetane Weite der Welt»3, wie auch die Erfassung gleichwertig aus «Sinneswahrnehmung» und «Sinnwahrnehmung» besteht.4 Es ist so ein über-sinnliches, ein denkendes Einkreisen, dann Erfassen des jeweiligen Ortes, Raumes — in situ —, das, als Löbbertsches Ergebnis, von einem intellektuell-spielerischen Intermezzo bestimmt wird.
So entstehen auf den jeweiligen Raum bezogene Arbeiten, die aus verändernden Eingriffen in die architektonische Substanz bestehen. Doch ist die Architektur dabei nicht Bildträger, Podest oder Podium postornamentaler artistischer Leistung. Sie ist Teil bzw. Resultat eines Trigesprächs, in das die Brüder Löbbert sowohl Skulpturales als auch Malerisches einflechten, allerdings immer unter Bezugnahme auf den ‹Höhlen›-Bewohner Mensch.
Schon in den frühen Arbeiten ist die intensive Beschäftigung mit dem qua Situation von der Architektur geprägten menschlichen Umfeld sichtbar. Die Sperrmüllarbeiten von 1985 bis 1987 beziehen sich stets deutlich auf ihre unmittelbare Umgebung. Die ‹Artefakte› der Ensembles, gefundene Möbel und sonstige, alltägliche Gegenstände — objet trouvé? — schmiegen sich in ihrer jeweiligen ‹Bedeutungslosigkeit› regelrecht ein in die Situation, werten sich und den Ort durch die jetzt — über die Kombination — irritierende Vieldeutigkeit jedoch wieder auf.
Nach orts- bzw. platzbezogenen Arbeiten kristallisierte sich bei den Brüdern Löbbert zunehmend das Interesse an der festgefügten Architektur heraus. Mit Integrationsobjekt Kanalstraße lassen sie den im ‹Normalgang› Vorübergehenden zumindest kurz innehalten: Eine eigentlich unauffällige Kaufhauswand in Hannover hat durch eine minimale Veränderung die Gewohnheit, die typisch deutsche Innenstadt-Alltagsarchitektur aus dem Lot gebracht.
Sie greifen Form und Struktur der Kaufhausfassade auf. Ein rechteckiger Körper lehnt schräg gegen die Häuserwand; der vorhandene Stromkasten wird durch eine Aussparung integriert; der Körper ist mit den gleichen Klinkern verkleidet wie die Wand, allerdings wird er um 90 Grad gedreht. Diese «unsere Arbeit», so Maik und Dirk Löbbert, «korrespondiert u. a. mit den Schaufenstervitrinen und der gekachelten Fassade, d. h. mit den für uns bereits vorhandenen Bildern, Skulpturen und Reliefs dieser ausgewählten Innenstadtsituation».5 So vollzieht sich, wie Lothar Romain schreibt, eine «Transmission von Fassade in Skulptur».6
Die Aufmerksamkeit soll auf die physische Beschaffenheit der Räume, auf die Architektur gelenkt werden. Deshalb benutzen die Brüder Löbbert Materialien, Formen und Elemente, die entweder an den jeweiligen Orten bereits vorhanden oder aber typisch sind für die Region. Da sind Stoffe, mit denen die Menschen ihren Lebensraum gestalten: Tapeten, Lampen, Farbe. Aber auch mit Wasser, Rotwein oder Steinkohle arbeiten sie, wenn dadurch ein Bezug zur Umgebung hergestellt ist. So lassen sich auch die Formen fast immer aus der vorhandenen Architektur ableiten; meist handelt es sich um geometrische Grundformen wie Kreis, Ring, Dreieck und Ellipse. Beispielsweise ‹malen› sie in Köln-Sülz mit Wasser auf den Bürgersteig ein gleichschenkliges Dreieck, das die Häuserecke aufgreift und allein durch den Hell-Dunkel- sowie Trocken-Naß-Kontrast sichtbar ist.
Künstler, die in der florentinischen Villa Romana weilen, werden vermutlich immer mit einem kulturhistorischen ‹Aspekt› dieser Region konfrontiert: dem toskanischen (Rot-)Wein. Ihn haben die Löbberts als Material genutzt, indem sie mit dieser natürlichen Farbe auf eine Wand eines weiteren kulturhistorisch bedeutsamen ‹Aspekts›, dem eines Klosters, einen Kreis malten. Doch bei allem künstlerischen Witz: Hier bildete die Freskomalerei den Quasi-Hinter- bzw. Untergrund für ein tief einziehendes, jedoch gleichermaßen vergängliches ‹Bild›.
Wo soeben noch Humor mit kulturhistorischer — im Sinne einer Ästhetik, die ihre Wurzeln im (heute so mißverständlichen wie mißbrauchten) Begriff ‹Schönheit› festgemacht hat, also vor der Mitte des 18. Jahrhunderts — Brillanz gepaart ward: Mit der der ‹Beleuchtung› von 1997 bricht der Löbbertsche Witz konterkarierend in den ‹heimeligen› öffentlichen Raum ein — in die Nostalgie, in die verklärende Erinnerung.7 In der Skulpturenmeile der Stadt Schwerte stand bereits eine dieser, die ‹gute alte Vergangenheit› herbeiziterenden Straßenlaternen. Maik und Dirk Löbbert setzten die Haube Neu-Alt aufs ‹rechte› Licht, indem sie eine Laterne neuesten Typs, eine der sogenannten Großstadtmöblierung darüberstellten.
Es ist auf der einen Seite der Respekt, mit dem die Löbberts einer kulturellen Entwicklung ihre Reverenz erweisen, andererseits aber auch die deutliche Kritik an ihr, die dieses Künstler-Paar kennzeichnet. Dabei sind Verbeugung sowie Ablehnung bildlich/räumlich zurückhaltend, in der Intention allenfalls ein wenig ketzerisch formuliert. Ihre Kunst erklärt sich in einem verhaltenen Ausdruck, der die These von Renato de Fusco von der Architektur als Massenmedium bzw. die von Henri Lefebvre aufgreift, die den Alltag als eigentliche menschliche Realität umreißt.
Die Löbbertsche Seh-Schule bringt den festgezurrten Kreis des Abgestumpften ins Ausfransen. Selbst der Flaneur (ob in Köln-Sülz, in Hannover oder) im sauerländischen Schwerte wird sich zunächst gar nicht wundern, um dann schließlich doch die Schritte zurückzugehen, die ihn angesichts der Beleuchtungs-Beleuchtung weiterbringen — es sind die minimalen, kaum ‹feststellbaren› Veränderungen am Ort, im Ort, an der Architektur, die den Rezipienten auf die Welt dieser anderen Realität bringen (oder auch nicht).
Wie der Mensch die Architektur, in der er sich ständig aufhält, kaum — und selten semiotisch — erfaßt, nimmt er auch die Bewegung weniger wahr. Letztere greifen Maik und Dirk Löbbert u. a. mit ihrer Arbeit von 1988 in der Universität Düsseldorf auf: Im 5. Stock des Gebäudes befindet sich ein Kreis aus dunkelgrauem Teppich, der so gelegt ist, daß sich ein Teil des Kreises in den Aufzugskabinen befindet. Sind die Aufzüge in Bewegung, fahren die Teilsegmente mit. Da ein Teil des Kreises somit immer in Bewegung ist, schließt sich der Kreis nie. Und hierbei geht es, wie Annelie Pohlen schreibt, «nicht um Projektionen eines geometrischen Weltbildes, sondern [um] ein physisch und geistig erfahrbares Konzept von Bewegung — zwischen allen Polen der Erstarrung, auch solchen der vermeintlichen Mobilität, wie sie die gegenwärtige Gesellschaft bis zur Selbsterschöpfung zelebriert».8
Mit ihrem Kunst-am-Bau-Projekt Teich + Stege im niederländischen Tilburg variieren die Löbberts das Thema Bewegung — und greifen zugleich die Architektur wieder auf, dringen in städteplanerisch sklerotische Denk-Strukturen ein. Sie lassen einen Teich mit zwei Stegen anlegen, die von gegenüberliegenden Seiten in ihn hineinragen. Es sind Wurmfortsätze des vorhandenen öffentlichen Radwegenetzes der Stadt. Doch sie zerreißen dieses Netz, indem die Spuren zwar Parallelen aufweisen, aber aneinander vorbeiführen bzw. im ‹Nichts› des Wassers enden.
Hatte der Unaufmerksame an anderen Löbbertschen Orten noch die Möglichkeit, unerkannt weiterzu-‹kommen›: Hier wird er radikal in seine (nicht nur visuellen) Grenzen zurückverwiesen; mit viel Glück für die sich aus der Wahrnehmung verabschiedende Menschheit?) wird er bei seiner Rückkehr in die städteplanerische Wohlbehütetheit über seine gewohnten Wege (möglicherweise) nachdenken.
Die Arbeiten von Maik und Dirk Löbbert sind nie von einem Zentrum aus zu (er-)sehen. Sie sind, wie die des Bildhauers, des Architekten zu ergehen, zu umgehen, um ins (geistige) Zentrum zu gelangen: dreidimensional, nein: mehrdimensional, vielschichtig eben.
Deutlich wurde das 1997 im Kunstverein Bonn. Im Gang der Artothek hatten sie in die Wand eine Öffnung gebrochen, deren Maß identisch war mit den Abmessungen der dort aufgehängten Bilder. Durch diese Öffnung wurde der (andere) Blick in den Ausstellungsraum des Kunstvereins möglich.
Das Welt-Bild der Renaissance, die Vorstellung vom Gemälde als einem geöffneten Fenster in die Welt (finistra aperta), ist hier aufgegriffen, der imaginäre Bildraum durch den realen ersetzt. Die Kunst (und in diesem Fall ist die Koppelung mit der Architektur statthaft) wird via Maik und Dirk Löbbert über die verschiedenen (Seh-)Ebenen reflektiert und somit auf diesen veritablen Widerspruch zurück-‹gehoben›: was sie ist und was sie sein muß: ohne Sockel, sondern vielmehr mit geistig-historischem Überbau versehen et vice versa.
Anmerkungen
1 Bernhard Waldenfels, Ordnungen des Sichtbaren, in: Gottfried Böhm (Hrsg.), Was ist ein Bild?, München 1994, S. 233
2 Ebenda
3 Victor-Emil von Gebsattel, in: Alexander Gosztonyi, Der Raum, Geschichte seiner Probleme in Philosophie und Wissenschaften, Freiburg/München 1976, Bd. II, S. 959
4 Wolfgang Welsch, Zur Aktualität ästhetischen Denkens, in: Kunstforum International, Bd. 100, April/Mai 1989, S. 134
5 Lothar Romain, Die Zurücknahme von Selbstdarstellungen, Vom Hinstellen zum Vor-Stellen von Kunst in der Stadt, in: Kat. Im Lärm der Stadt, 10 Installationen in Hannovers Innenstadt, hrsg. v. Lothar Romain, Hannover 1991, S. 17
6 Lothar Romain, a. a. O., S. 17
7 Ein von Wolfgang Ruppert geprägter Begriff; Nostalgie: Verklärung der Erinnerung
8 Annelie Pohlen, aus einem unveröffentlichten Manuskript
Künstler — Kritisches Lexikon der Gegenwartskunst, Ausgabe 43, 3. Quartal, Heft 43, München 1998;
Mitarbeit: Anne Schloen
© Für den Text: Detlef Bluemler und Zeitverlag (ehemals WB-Verlag);
für die Abbildungen © Maik + Dirk Löbbert
| Di, 01.12.2009 | link | (4292) | 0 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Bildende Kunst |
Poetische Vernunft
Über Christoph Rihs
 «Künstler ist jemand, der darauf besteht, hinter den Aussagen, die er trifft, selber sichtbar zu bleiben, nicht wie in der Wissenschaft, wo in einem hohen Grade anonymisiert werden soll bis hin zu der Anonymität der Aussage eines Gesetzes, als sei es vom Himmel gefallen.»1 Das sind Bazon Brocks Worte. Lucius Grisebach ist ebenso gegen eine »namenlose Kunstbetrachtung, doch er warnt: Es geschehe häufig, daß man die Künstler nicht ihrer «Kunst wegen liebt, sondern weil sie dem Bürger so schön verloren erscheinen».2
«Künstler ist jemand, der darauf besteht, hinter den Aussagen, die er trifft, selber sichtbar zu bleiben, nicht wie in der Wissenschaft, wo in einem hohen Grade anonymisiert werden soll bis hin zu der Anonymität der Aussage eines Gesetzes, als sei es vom Himmel gefallen.»1 Das sind Bazon Brocks Worte. Lucius Grisebach ist ebenso gegen eine »namenlose Kunstbetrachtung, doch er warnt: Es geschehe häufig, daß man die Künstler nicht ihrer «Kunst wegen liebt, sondern weil sie dem Bürger so schön verloren erscheinen».2«Die Schweizer», so Bertrand Theubet, «überleben eben eher, als daß sie leben.»3 Christoph Rihs ist Schweizer. Geboren ist er im libanesischen Beirut. Überlebt hat er in Biel oder Bienne. Dort hat er seine Maturaprüfung absolviert. Dazu gehörte das Französische. Es liegt hinter dem sogenannten Rösti-Graben, der auch Mentalitäten trennt. Und beim letzten (wirklichen?) euro-mondialen Grenzhäuschen setzt eine andere der vielen schweizerischen Sprachen ein: das Italienische. In ihm hat Rihs sich ebenfalls einige Zeit wie in Mamas Sprach- und Mentalitätschoß gefühlt. Unter anderem 1983 bis 1984 in Rom. Entscheidende, lange Jahre stand sein Atelier im rheinischen Düsseldorf, wo er studiert hat. Im burgundischen Bourguignon ruht ein ehemaliger Bauernhof. In dem erwartet man jeden Augenblick, daß es heißt ‹Film ab› und die Pariser zur Landpartie des Week-ends einrollen. Doch es kommt ein eher derber Kastenwagen. Aus ihm hüpfen dann: französischer Hund, US-amerikanische Mutter einer gemischten Tochter und der dazugehörige Papa. Man möchte die Internationale singen.
Die Rihs-Familie hat eine davon erhellte Wohnung inmitten der Heim-Stadt der deutschen Klassik: Weimar. Doch nicht in der heimeligen Stadt der Goethe-Aufkleber lebt die Rihs-Familie (auch), sondern in der Heimstatt der Bauhaus-Universität. Bauhaus — die Werkstatt der Moderne. Am Bauhaus herrschte eine Vernunft, deren Aufklärungskanal so berechnet war, daß der bisweilen ausufernde Wildbach Romantik (s)eine Aue hatte. Aus Liberté, Égalité, Fraternité flossen Vielfalt, Ganzheit, Einheit und wieder zurück. Jeder Mensch ist ein Künstler. Das hat Beuys so nie gesagt. Beuys meinte allenfalls, jeder Mensch sei kreativ. Beuys kannte die Romantik gut. Sein vielzitierter ‹anderer Kunstbegriff› ist in ihr, ist (auch) in Novalis beheimatet. Vielleicht ist es Beuys ja so ergangen wie dem armen Juden bei Kurt Tucholsky. Der erfand eines Tages etwas: die Differentialrechnung. Doch als er in die große Stadt kam, stellte er fest, daß sie bereits erfunden war. Es gibt keinen Neuschnee.4
Christoph Rihs entdeckt ebenfalls ständig Neues im Bestehenden, zum Beispiel in der Geometrie, diesem «Teilgebiet der Mathematik, das aus der Beschäftigung mit den Eigenschaften und Formen des Raumes, wie der Gestalt ebener und räumlicher Figuren, Berechnung von Längen, Flächen, Inhalten [...] entstand».5 Er weiß um diese Vernunft, die sich aus der Verknüpfung von Erkenntnissen ergibt. Geometrie? Orientierung: «Das heißt, sich zurechtfinden, meint die Wahl treffen zwischen mehreren Möglichkeiten und sie zusammenfügen zu können zum erwünschten Resultat eines verheißungsvollen Weges: Erfolg- oder gewinnversprechend. Die ursprüngliche Bedeutung kommt aber von Orient (ex oriente lux; aus dem Osten [kommt] das Licht) und bezieht sich auf die Anschauung, daß alle Kultur (wie die Sonne eben?) aus dem Osten kommt (Ausrichtung nach Osten z. B. der Kirchen, Chöre, Altäre).»6
 Orientierungshilfen haben Christoph Rihs von klein an fasziniert. Früh hat Rihs das (Karten-)Lesen spannender empfunden als (Fern-)Sehen. Er zog eben lieber auf der Landkarte eine (gedankliche) Linie. Landkarten. Kartographie. Geometrie. Die Geometrie ist das Denkmodell des Menschen. «Und das Spannende daran», so Rihs, «ist ja, daß der Mensch ohne Denkmodell nicht leben kann.»7 So wuchsen anfänglich farbige Linien oder Objekte aus Holzleisten auf Fußböden oder Wänden. In Dufourstr. von 1981 ist es Kreide. Es sind Bewegungsabläufe. Rihs hat eine bestimmte Anzahl von Gängen festgehalten. So entstanden Bilder, «ähnlich denen eines Ballettänzers», wie Marie-Luise Syring feststellt. «Aber diese Arbeit hatte weder etwas mit den ritualisierten, abstrakten Bewegungsmustern eines Tänzers zu tun, noch ging es darum, den Raum zu ermessen, abzuschreiten oder irgend zu erfassen. [...] Welche Bedeutung die Aktionen des umhergehenden Besuchers hatten, ob sie durch Anziehung oder Abstoßung hervorgerufen waren, das wird an den Linien nicht ablesbar. Eine psychologisierende Lektüre bleibt also ausgeschlossen.»8 Christoph Rihs wollte den mechanischen Sehvorgang verdeutlichen, «dieses Abbild, das wir im Augapfel selbst tragen, als ein materielles Bild, das man wieder nach außen tragen kann, einen Zug mit Linien, mal Wollfäden mit Gummiseilen oder Kreidelinien auf dem Fußboden». Marie-Luise Syring legt in ihrer luziden Analyse jedoch — quasi wegweisend — nach: «[...] die Interaktion zwischen Objekt und Mensch. Die Dinge wirken über unsere Sinne hinaus und vornehmlich über das Auge auf den Geist, das heißt, die Erkenntnis und die Handlungsweise des Einzelnen (Maurice Merleau-Ponty hat dies auf bestechende Weise in L'Œil et l'Ésprit, 1964, beschrieben und u. a. damit den idealistischen Begriff der reinen Vernunft seiner Kritik unterzogen), genau wie unser Handeln auf die Dinge einwirkt.»9 Der französische Existentialist und Phänomenologe Merleau-Ponty — in einer Richtung zu denken mit Hedwig Conrad-Martius, Emmanuel Lévinas, Paul Ricœur und Edith Stein — bezeichnet den Leib als unser «Sein zur Welt». Er ist der Ort, in dem Sprache, Wahrnehmung, Handlung und Orientierung (sic!) auf andere wie auf die Welt stattfindet.10 «Ein menschlicher Körper ist vorhanden, wenn es zwischen Sehendem und Sichtbarem [...], zwischen einem Auge und dem anderen [...], wenn jenes Feuer um sich greift, das unaufhörlich brennen wird [...].»11
Orientierungshilfen haben Christoph Rihs von klein an fasziniert. Früh hat Rihs das (Karten-)Lesen spannender empfunden als (Fern-)Sehen. Er zog eben lieber auf der Landkarte eine (gedankliche) Linie. Landkarten. Kartographie. Geometrie. Die Geometrie ist das Denkmodell des Menschen. «Und das Spannende daran», so Rihs, «ist ja, daß der Mensch ohne Denkmodell nicht leben kann.»7 So wuchsen anfänglich farbige Linien oder Objekte aus Holzleisten auf Fußböden oder Wänden. In Dufourstr. von 1981 ist es Kreide. Es sind Bewegungsabläufe. Rihs hat eine bestimmte Anzahl von Gängen festgehalten. So entstanden Bilder, «ähnlich denen eines Ballettänzers», wie Marie-Luise Syring feststellt. «Aber diese Arbeit hatte weder etwas mit den ritualisierten, abstrakten Bewegungsmustern eines Tänzers zu tun, noch ging es darum, den Raum zu ermessen, abzuschreiten oder irgend zu erfassen. [...] Welche Bedeutung die Aktionen des umhergehenden Besuchers hatten, ob sie durch Anziehung oder Abstoßung hervorgerufen waren, das wird an den Linien nicht ablesbar. Eine psychologisierende Lektüre bleibt also ausgeschlossen.»8 Christoph Rihs wollte den mechanischen Sehvorgang verdeutlichen, «dieses Abbild, das wir im Augapfel selbst tragen, als ein materielles Bild, das man wieder nach außen tragen kann, einen Zug mit Linien, mal Wollfäden mit Gummiseilen oder Kreidelinien auf dem Fußboden». Marie-Luise Syring legt in ihrer luziden Analyse jedoch — quasi wegweisend — nach: «[...] die Interaktion zwischen Objekt und Mensch. Die Dinge wirken über unsere Sinne hinaus und vornehmlich über das Auge auf den Geist, das heißt, die Erkenntnis und die Handlungsweise des Einzelnen (Maurice Merleau-Ponty hat dies auf bestechende Weise in L'Œil et l'Ésprit, 1964, beschrieben und u. a. damit den idealistischen Begriff der reinen Vernunft seiner Kritik unterzogen), genau wie unser Handeln auf die Dinge einwirkt.»9 Der französische Existentialist und Phänomenologe Merleau-Ponty — in einer Richtung zu denken mit Hedwig Conrad-Martius, Emmanuel Lévinas, Paul Ricœur und Edith Stein — bezeichnet den Leib als unser «Sein zur Welt». Er ist der Ort, in dem Sprache, Wahrnehmung, Handlung und Orientierung (sic!) auf andere wie auf die Welt stattfindet.10 «Ein menschlicher Körper ist vorhanden, wenn es zwischen Sehendem und Sichtbarem [...], zwischen einem Auge und dem anderen [...], wenn jenes Feuer um sich greift, das unaufhörlich brennen wird [...].»11Christoph Rihs stellt den Betrachter, den Menschen ins Zentrum seines Zentrums, seines Globus, seines Weltbildes. Manchmal ist diese Welt wie im richtigen Leben sehr klein und komisch (mondo mio, 1984; der Globus oben links). Doch dann wieder verändert sie sich und ihr Bild. Es ergeben sich die unterschiedlichsten Perspektiven. Dann entstehen Weltbilder (1991).
Manchmal werden sie begraben: L'enterrement (1989). Oder sie sind Vorläufer für Vorbilder. Video. Ich sehe. In einem Videoband für ein Projekt der RWE laufen im historischen Zeitraffer ‹Kathedralen› ab: Pyramide, Tadsch Mahal, Minarett (ex oriente?), Pisa, Eiffelturm, Wasserturm, Fernsehturm — Kühlturm. Christoph Rihs' Weltbild auf dem 131 Meter hohen Kühlturm 1 (auch hier) des Gaskraftwerks Meppen im Emsland erhielt 1994 den einstimmigen Zuschlag der Jury unter dem Vorsitz von Ulrich Krempel. Für das RWE-Vorstandsmitglied Werner Hlubak lag die Faszination «vor allem» im Hinweis darauf, daß «die Welt Strom braucht, Elektrizität braucht». Christoph Rihs schmunzelte dazu seine An-Sicht: «[...] daß das Weltbild stark genug ist, etwas anderes hervorzurufen».12 Und siehe: Beispielsweise zwischen diesem Rihsschen Weltbild und der verniedlichenden Bemalung des südfranzösischen Kernkraftwerkes Cruas-Meysse (weitere Abbildung) an der Rhône liegen Welten. Nicht nur wegen des Unterschieds zwischen Gas und Atom. «Das eine ist der Schaffenstrieb des Menschen», so Rihs, «das andere ist, was man mit dem, was man getan hat, eigentlich angerichtet hat. Dies korrigierend zu untersuchen, das ist mein Arbeiten.»
«Wenn ich meinen Verstand benutze», stellt Bazon Brock fest, «um die Mechanismen aufzuklären, denen ich im Denken, im Sprechen unterliege, dann ist das ein reflexiver Akt. Und das ist in der Kunst immer der Fall gewesen, denken Sie beispielsweise an Maler wie Magritte, die ihre ganzen Themenœuvres nur aus der Aufklärung über diese reflexiven Mechanismen gewinnen. [...] Wir können Maschinen bauen, da gibt es ein bestimmtes Tun, die Folgewirkung dieses Tuns können wir aber nicht auf die gleiche Weise bewältigen wie das ursprüngliche Maschinenbauen oder das ursprüngliche Produzieren. Das sind Mechanismen, die die Kunst seit 500 Jahren erklärtermaßen zu ihren entscheidenden Fragestellungen gemacht hat, deswegen ergibt sich auf ganz natürliche Weise ein enger Zusammenhang zwischen künstlerischen und ästhetischen Problemstellungen einerseits und den ökologischen Debatten andererseits, soweit überhaupt eine Chance besteht, diese ökologischen Debatten ernstzunehmen.»13 «Jeder Künstler», meint Christoph Rihs, «durchläuft mit jeder Arbeit erneut die Stadien der Suche nach formalem und inhaltlichem Ausdruck.»14
«Die Welt ist angeeignet, funktionalisiert, entmythisiert und entromantisiert», schreibt André Lindhorst, sich auf Rihs' Arbeit beziehend.15 Entromantisiert? Eine Ruine ist uns geblieben: die schlaffe Hülle der Pandora. Und unser Sehnen flattert feixend um uns Ahnungslose herum. Doch woher soll der modern Aufklärungswillige es auch wissen, er, der auch der Information wegen in Kunstausstellungen geht? Der Katalog zu vier Jahrhunderten spanische Malerei erläutert das Stilleben, das Bodégon, das aus dem Keller, der ärmlichen Spelunke kommt, als ein «ein lustiges Cabinett mit allerlei Eßbarem, was im spanischen Klima wächst».16 Daß «die dargestellten Gegenstände der Stilleben [...] in symbolischem und theologischen Sinn auf den Menschen» verweisen, in «Bildern die Welt deuten oder an die Vergänglichkeit alles Irdischen», wird erst gar nicht (mehr?) erwähnt. Weder in einem der fünf Katalogaufsätze noch in einer der Bildbeschreibungen wird auf die religiöse, ergo politische Symbolik der Stilleben hingewiesen, etwa, «daß im Granatapfel die Einheit der Kirche mit ihrer großen Menge an Gläubigen aufgeht oder er auch als Zeichen der Auferstehung gilt.»17
Der Mensch von heute habe sich die Erde zum Gegenstand seiner globalen Projektionen gemacht, hält André Lindhorst fest. «Wie fragwürdig diese sind, darauf weist die Kunst von Christoph Rihs hin.»18 Mit diesem Satz beatmet Lindhorst — in Rihs — allerdings etwas, das er eine Sentenz zuvor beerdigt hatte: die Romantik. Der Künstler Jochen Gerz, alles andere als ein Priester des entkernten Gefühls, meinte: «In der Romantik kommt es zur Panne des Auftrags, eigentlich ein schöner Moment, unglaublich scharf und ohne jede Entschuldigung. Scharfgestellt wird auf die Kunst [...]. Die Kunst ohne Dauer, Publikum, Auftrag. [...] Das ist auch politisch. Das entspricht einem fast französischen Begriff des Politisierten [...].»19
Der Begriff der Romantik ist aus dem des Romans abgeleitet. Die Romantik leben war gleichbedeutend mit «La vie est un roman — das Leben ist ein Roman». So bedeutet Romantik auch, hier über Novalis: «Chaotisieren, verwirren, anarchisieren — das waren Begriffe und Praktiken, die die Frühromantiker durchaus positiv verwandten.»20 Und das liest sich so: «Billig stellt der Künstler die Thätigkeiten oben an, denn sein Wesen ist Thun und Hervorbringen mit Wissen und Willen, und seine Kunst ist, sein Werkzeug zu allem gebrauchen, die Welt auf seine Art nachbilden zu können, und darum wird das Princip seiner Welt Thätigkeit, und seine Welt seine Kunst. Auch hier wird die Natur in neuer Herrlichkeit sichtbar, und nur der gedankenlose Mensch wirft die unleserlichen, wunderlich gemischten Worte mit Verachtung weg.»21 Paul Eluard bemerkte, dem Romantiker sei der Inhalt eines Wasserglases ebenso von poetischer Bedeutung wie der Meeresgrund. «Ein Künstler kann käuflich sein», meint Christoph Rihs, «und sein Produkt, eine Materialisierung seiner ‹Forschung›, ist natürlich zu kaufen. Aber damit hat man nicht ‹die Kunst› gekauft; diese sprießt ähnlich wie eine Eselsdistel, weitverzweigt unterirdisch, um da aufzutauchen wo man sie vielleicht erwartet, aber oft dort, wo wir sie nicht erwarten.»22
Vernunft und Ästhetik
Vernunft ist kein abstraktes Gebilde, das man wenden kann, wie's das geldwerte Nützlichkeitsprinzip wünscht. Vernunft ist das Siècle des lumières, das Zeitalter der Erhellung (des Geistes). Sie ist gleichermaßen Déscartes' physikalisches wie philosophisches Licht. Aber sie ist ganz sicher auch ‹laisser-faire›: dem Sein der Eselsdistel den Weg lassen. Bei Douglas Adams wird der Mensch von der Labormaus an der langen Leine gehalten, im Universum.23 Rihs taumelt schmunzelnd durchs All, durch sein «Egoversum»: «Aus Realität und Vorspiegelung, einer Mischung aus beiden, setze ich meine Wirklichkeit zusammen.»24 Sein Maikäfer flieg!, entlehnt dem Kinderlied aus der Zeit des dreißigjährigen Krieges, mag an dieses Gemetzel erinnern. Es kann jedoch genauso ein kindlicher Brummkreisel sein, der die Adamssche Bauflotte der Vogons stört, die den Auftrag hat, die Erde zu sprengen. Sie torkelt, sich den Plänen einer intergalaktische Einbahnstraße widersetzend, durchs All. «Ich finde es eine seltsame Formulierung, wenn ein Künstler sagt, wonach er sucht. Ich kann es nicht. Ganz bestimmte Sachen tauchen bei mir repetetiv auf. Aber formulieren, was das ist, kann ich nicht.» Auch die Wahl des Stoffes seiner Vor-Stellungen ist dabei völlig ohne Belang. «Ich wähle nicht ein Material, weil ich mich damit glücklich fühle, sondern ich gehe damit intuitiv um und frage später nach der Technik.»
 Wir stehen am Ufer des schweizerischen Neuenburger Sees und sind verzaubert vom Schilf, das da aus dem Morgennebel auftaucht. Genau so flirrt es durch unser Wissen, dieser Seele des 18. und noch 19. Jahrhunderts, in unserer romantischen Verzücktheit, Entrücktheit. Gerade heute, im technoiden Zeitalter, wünschen wir uns so die Tage, die Natur, die uns aufhebt, die gegen den Raubbau an ihr hält. Ruhe. Stille. Beinahe so schön ist's, als ob Caspar David Friedrich es gemalt hätte. Gar des sehr frühen Romantikers Antoine Watteau Einschiffung nach Kythera von 1717 fährt uns in die Sinnlichkeit. Arkadien. Die Sonne durchdringt den Nebel, drängt durch, hebt ihn auf. Der Kopf wird entwattiert, entäußert sich. Geräusche. Ein Klingeln. Ist's das Läuten der schrecklichen Wirklichkeit? Fürwahr. Ein Trugbild war's. Aus dem Möchtegern-Welt-Bild wird eine rauhstelzige Realität. Das Schilf besteht aus Angelruten. An ihnen hängen Schellen, wie man sie (auch) aus der allemannischen Faßnacht in den Ohren hat: Fischbißanzeiger-Geläut, das zeigt, daß wir am Haken hängen. Es hallt uns in den Ohren, dieses homerische, schallende, nicht endenwollende Gelächter aus der Ilias und der Odyssee des Christoph Rihs: Schilf (2002).
Wir stehen am Ufer des schweizerischen Neuenburger Sees und sind verzaubert vom Schilf, das da aus dem Morgennebel auftaucht. Genau so flirrt es durch unser Wissen, dieser Seele des 18. und noch 19. Jahrhunderts, in unserer romantischen Verzücktheit, Entrücktheit. Gerade heute, im technoiden Zeitalter, wünschen wir uns so die Tage, die Natur, die uns aufhebt, die gegen den Raubbau an ihr hält. Ruhe. Stille. Beinahe so schön ist's, als ob Caspar David Friedrich es gemalt hätte. Gar des sehr frühen Romantikers Antoine Watteau Einschiffung nach Kythera von 1717 fährt uns in die Sinnlichkeit. Arkadien. Die Sonne durchdringt den Nebel, drängt durch, hebt ihn auf. Der Kopf wird entwattiert, entäußert sich. Geräusche. Ein Klingeln. Ist's das Läuten der schrecklichen Wirklichkeit? Fürwahr. Ein Trugbild war's. Aus dem Möchtegern-Welt-Bild wird eine rauhstelzige Realität. Das Schilf besteht aus Angelruten. An ihnen hängen Schellen, wie man sie (auch) aus der allemannischen Faßnacht in den Ohren hat: Fischbißanzeiger-Geläut, das zeigt, daß wir am Haken hängen. Es hallt uns in den Ohren, dieses homerische, schallende, nicht endenwollende Gelächter aus der Ilias und der Odyssee des Christoph Rihs: Schilf (2002).«Ich kann nicht präzise sagen, warum ich Kunst mache. Ich versuche, Probleme zu lösen.» Christoph Rihs löst unsere Probleme ästhetisch. Doch Ästhetik bedeutet nicht mehr die ‹Lehre vom Schönen›, ist nicht mehr die apollinische Form ohne Tiefe, das klassische Ideal ihres Beschwörers Johann Joachim Winckelmann. Ästhetik meint seit der Aestetica aus den Jahren 1750/1758 des Alexander Gottlieb Baumgarten die Darstellung unterschiedlicher Auffassungen. «Dann heißt das», so Bazon Brock: «wir brauchen gar keine Antwort auf die Frage, das Interessante ist bereits die Frage selbst, nämlich: Wie kommen die unterschiedlichen Urteile angesichts gleicher Urteilsgegenstände und ziemlich gleicher Ausrüstung aller Menschen mit dem gleichen Urteilsapparat zustande, vor allem, was bedeuten diese unterschiedlichen Urteile?»25
So kann aus einem Schiff ein Fisch werden und der wieder zum Schiff oder zu einer anderen Erkenntnis (Schiff, 2000). In Erfurt hing dieses Hybridwesen als Ergebnis einer Rihsschen Bildgeburt. Rihs sieht sie jedoch weniger als Metapher denn als Wortspiel: «als ein technisches Produkt, das eigentlich Fähigkeiten des Fisches aufnimmt, sich in einem Medium zu bewegen, was nicht unseres ist». Das Medium war der Dom zu Erfurt. «Den sensiblen und sichtbaren Punkt des Übergangs zwischen Spätromanik und Gotik», schreibt Anne Maier, «hat Christoph Rihs als ‹Ankerplatz› für sein Luftschiff auserkoren. Der Chorhals mit zwei Nebengelassen stammt vom spätromanischen Bau und ist vermittelndes Glied zwischen dem älteren Querhaus und dem spätgotischen, stark überhöhten Chor. Durch diesen künstlerischen Eingriff wird die Bedeutung des Bindegliedes zwischen altem und neuem Bau, alter und neuer Kirche hervorgehoben. [...] Doch Christoph Rihs [...] will mehr als nur die Illusion des Fliegens erzeugen. Er greift mit seinem schwebenden Schiff in den Prozeß der Entkörperlichung und Vergeistigung des gotischen Kirchenbaus ein. Sein Skelett aus Edelstahl, verstärkt mit Spanten aus Aluminium, das von Bug und Heck ausgehend von einem kreisförmig laufenden drei Millimeter dicken Stahlseil umspannt wird, erscheint als objekthafter Kommentar einer Harmonie des Göttlichen. Bernard de Clairvaux entwickelte die geistigen Grundfesten zu der Lehre des gotischen Kathedralenbaus. So stellt sich der Chorhals als der Übergang vom sogenannten ‹ungeistigen›, prächtigen und selbstbewußten romanischen Stil hin zum durchgeistigten, wider jede Vorstellung von Schwerkraft löckende Gotik dar. Rihs befaßt sich seit längerer Zeit in seiner Arbeit mit der Überlegung, wie ein Sich-in-Gedanken-von-der-Erde-Wegbewegen visuell umgesetzt werden könnte.»26
 Im Gegensatz zur Evokation seiner Weltbilder gehe es ihm hierbei jedoch nicht um den Künstler und dessen Modell oder gar den Traum vom Fliegen. Es gehe um die Erkenntnis, also zunächst um das Erkennen. ICHTHYS ist das griechische Wort für Fisch. Es diente den ersten Christen als Codewort des gegenseitigen Erkennens. Denn aus diesem Begriff ergibt sich eine Formel: ‹Jesus Christus, Sohn Gottes, Retter›. Daraus ergibt sich eine Reflexion, über die man zu unterschiedlichen Urteilen kommen kann. Bei Anne Maier ist die Definition so angelegt: «Fisch oder Schiff — Christoph Rihs läßt eine präzise Zuordnung offen, schafft Raum für die Phantasie der Kunst und den Reichtum der religiösen Gedanken. Er bestätigt Martin Bubers religiöse Erfahrung, als die einer Anderheit, die in den Zusammenhang des Lebens nicht eingebunden werden konnte. Das ‹Religiöse› hob einen heraus. Drüben war nun die gewohnte Existenz mit ihren Geschäften, hier aber waltete Entrückung, Erleuchtung, Verzückung, zeitlos, folgelos. Das eigene Dasein umschloß also ein Dies- und ein Jenseits, und es gab kein Band außer jeweils dem tatsächlichen Augenblick des Übergangs. [...] Wenn das Religion ist, so ist sie einfach alles, das schlichte gelebte Alles in seiner Möglichkeit der Zwiesprache.»27
Im Gegensatz zur Evokation seiner Weltbilder gehe es ihm hierbei jedoch nicht um den Künstler und dessen Modell oder gar den Traum vom Fliegen. Es gehe um die Erkenntnis, also zunächst um das Erkennen. ICHTHYS ist das griechische Wort für Fisch. Es diente den ersten Christen als Codewort des gegenseitigen Erkennens. Denn aus diesem Begriff ergibt sich eine Formel: ‹Jesus Christus, Sohn Gottes, Retter›. Daraus ergibt sich eine Reflexion, über die man zu unterschiedlichen Urteilen kommen kann. Bei Anne Maier ist die Definition so angelegt: «Fisch oder Schiff — Christoph Rihs läßt eine präzise Zuordnung offen, schafft Raum für die Phantasie der Kunst und den Reichtum der religiösen Gedanken. Er bestätigt Martin Bubers religiöse Erfahrung, als die einer Anderheit, die in den Zusammenhang des Lebens nicht eingebunden werden konnte. Das ‹Religiöse› hob einen heraus. Drüben war nun die gewohnte Existenz mit ihren Geschäften, hier aber waltete Entrückung, Erleuchtung, Verzückung, zeitlos, folgelos. Das eigene Dasein umschloß also ein Dies- und ein Jenseits, und es gab kein Band außer jeweils dem tatsächlichen Augenblick des Übergangs. [...] Wenn das Religion ist, so ist sie einfach alles, das schlichte gelebte Alles in seiner Möglichkeit der Zwiesprache.»27«Kann sich im Vergleich von Kunst und Religion resp. Kirche aufgrund von Parallelen in der Orientierung eine Zusammenarbeit ergeben?» fragt Christoph Rihs. «Die Werte in der Kunst (zur Zeit!) werden von den Künstlern (und im Gefolge deren Interpreten) immer aufs neue geprägt, wogegen die Religion ihre in der ‹Schrift› (Veda, Pali, Bibel, Tanach, Koran, etc.) niedergelegten Werte als Orientierung anbietet. Glauben vs. Erkenntnis? Das eine reflektiert eine (moderne) Welt, in der jeder seine Werte selbst zusammenstellen kann, dies aber auch selbst tun muß; das andere spiegelt die (Tradition der) Menschengeschichte wieder: Die Herrschaft manchmal aus derselben Hand wie die Hilfestellung. Hier liegt meines Erachtens eine hohe Mauer, die in Anbetracht der Arbeitsweise heutiger Künstler ein Arm in Arm zu gehen ausschließt.»28 Hier war der ‹bespielte› Raum eben eine Kirche, ein Dom zudem, der weit hinaufgreift in ein Universum, das an diesem Ort jenem Herrn zugeordnet wird, dem eine Religion gewidmet wurde. Anne Maier irrt also keineswegs. Lediglich ihre Perspektive in die Endlosigkeit ist eine andere.
In das andere Endlose greift Rihs gerne. Allerdings eher weniger auf der Suche nach ‹ihm›. Rihs grüßt mit Hello Halley Maikäfer flieg! schon eher ironisch den hellsten unter den Kometen, der uns 1986 das letzte Mal erhellt und Zeitungen und Fernsehen und damit uns alle gewaltig erleuchtet hat. Und so, wie bei Rihs Hello Halley an eine Bastelwerkstatt erinnert, assoziert die lädierte Giotto, die Raumsonde, die eigens für die Beobachtung von (Hello) Halley ins All geschossen wurde. Novalis erklärt diesen Denkvorgang so: «Wenn der Denker [...] mit Recht als Künstler den thätigen Weg betritt, und durch eine geschickte Anwendung seiner geistigen Bewegungen das Weltall auf eine einfache, räthselhaft scheinende Figur zu reduciren sucht ...»29
Der Erden Ball
Christoph Rihs ist multiplex aufgewachsen. Sein osservatorio romano (1985) würde er wieder schmunzelnd Wortspiel nennen. Der Osservatore Romano des Heiligen Stuhls ist der journalistische geistliche Beobachter einer weltlichen Welt. Der osservatorio romano ist die astronomische Beobachtungsstation des poetisch aufklärenden Christoph Rihs. In einer Parallele — Seh-Raum von 1983, der auch Egoversum tituliert wurde — kratzt Marie-Luise Syring mit dem Federkiel an der dann fröhlich blutenden Wunde: «Ein solcher Kommentar [...] bedeutet mehr als die bloße Umsetzung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse in die Sprache der Fiktion. Er bildet sozusagen das Instrumentarium einer Innenschau und wird gleichzeitig zum Sinnbild einer nach innen und außen hin offenen Welt-Anschauung im doppelten Sinn des Wortes.»30
So trifft das Rihssche Egoversum auch auf das von Johannes Brahms. Im thüringischen Meiningen, also nicht weit vom Dach, unter dem Goethe und Schiller (Die Wahrheit ist nur mit List zu verbreiten) gemeinsam archiviert sind, durfte Brahms durch die Vermittlung des befreundeten Dirigenten Hans von Bülow eine enge Beziehung zum dortigen kleinen Fürstentum herstellen und dessen Orchester bespielen. Christoph Rihs hat das via Bols (1999) mit Meiningen getan. Auch hier hat Rihs zunächst einmal wieder in die Sterne gegriffen. Modell für dieses Modell stand der Erdapfel, den der Kosmograph Martin Behaim 1492 fertiggestellt hat, der erste erhaltene Globus. «bols sind aufgelöste Darstellungen von Welt, den Blick auf die Natur käfigartig fassend. Wenn von einer Globendarstellung nur die Geometrie übrigbleibt, stellt dies für mich die Reduktion des Konzeptes ‹Weltabbild› auf den Ursprung und Angelpunkt jedes Denk-Modells dar.»31
Die etwas älteren kennen Bols. Bols-Blau, der Aperitif, der ein so seltsames Sirren im Kopf hervorrief. Ähnlich der Ver-Ball-Hornung von Balls: Balls of Brahms. Der Dadaist Hugo Ball böte sich ebenfalls an, in dessen Vorwort zum Buch Byzantinisches Christentum Waldemar Gurian darauf hinweist, daß im modernen Abendlande die «symbolische Betrachtung der Geschichte fast ganz vergessen worden ist».32 Eine Annäherung an den Globus legt der französische Ball nahe, der Ballon heißt. Womit wir beim schwebenden oder hüpfenden Gebilde des Rainer Maria Rilke wären:
«Du Runder, der das Warme aus zwei Händen
im Fliegen, oben, fortgibt, sorglos wie
sein Eigenes; was in den Gegenständen
nicht bleiben kann, zu unbeschwert für sie,
zu wenig Ding und doch Ding genug,
um nicht aus allem draußen Aufgereihten
unsichtbar plötzlich in uns zu entgleiten:
noch unentschlossener: der, wenn er steigt,
als hätte er ihn mit aufgehoben,
den Wurf entführt und freiläßt —, und sich neigt
und einhält und den Spielenden von oben
auf einmal eine neue Stelle zeigt,
sie ordnend wie zu einer Tanzfigur,
um dann, erwartet und erwünscht von allen,
rasch, einfach, kunstlos, ganz Natur,
dem Becher hoher Hände zuzufallen.»33
Vom «fortwährenden Vergeuden aller wandelbaren Werte»34, erzählt Rainer Maria Rilke noch: in der endlosen Wißbegierigkeit nie aufhören zu spielen.
Es gibt ein schweizerisches Spezifikum, der einen spezifischen schweizerischen Humor hervorgebracht hat. Ersteres ist der unbändige Ordnungswille. Und in ihm und mit ihm wird gerne kaschiert. Sicher hat Milan Kundera nicht die Schweiz gemeint, aber er hat unumstößlich gefolgert: «... daß das ästhetische Ideal des kategorischen Einverständnisses mit dem Sein eine Welt ist, in der die Scheiße verneint wird und alle so tun, als existierte sie nicht. Dieses ästhetische Ideal heißt Kitsch.»35
Die Modernität, schrieb der Sur-Naturalist36 Charles Baudelaire 1863, ist das Vorübergehende, das Entschwindende, das Zufällige. Oder: «Das Schöne ist immer bizarr.»37
Anmerkungen
1 Bazon Brock, in: Interview mit dem Autor zum Thema Ökologie und Ästhetik für den Westdeutschen Rundfunk, Köln 1982
2 Lucius Grisebach: Der Maler Werner Heldt, in: W. H., hrsg. v. Lucius Grisebach, Kat. Kunsthalle Nürnberg (u. a.), Nürnberg 1990, S. 66
3 Bertrand Theubet, in: Schweizer Abgründe, Dokumentation, arte, 21.08.02, 20.45 h
4 Kurt Tucholsky: Es gibt keinen Neuschnee, in: Gesammelte Werke 1925 — 1926, Rowohlt, Reinbek 1993 (181 Aufl.), Bd. 9, S. 74f.
5 Brockhaus PC-Bibliothek 3.0, 2001
6 Rihs in einem eMail an den Autor am 27.9.2001
7 Christoph Rihs im Gespräch mit dem Autor im französischen Bourguignon (Bourgogne) am 15. Mai 2001; soweit nicht anders gekennzeichnet, entstammen die Zitate diesem Gespräch
8 Marie-Luise Syring: Eine Anatomie des Sehens, in: Monde, Ausst.-Kat. (deutsch und französisch) Faux-Mouvement, La Cour d'Or, Musées de Metz, 1989, S. 8ff.
9 Marit Rullmann und Werner Schlegel: Leib- statt Vernunftphilosophie, Frankfurt am Main 2000, S. 101
10 Maurice Merleau-Ponty: Das Auge und der Geist (L'Œil et l'Ésprit), Hamburg 1984, S. 17
11 ibd.
12 Videoband der RWE, 1994
13 Bazon Brock, ibd.
14 Rihs-eMail, 27.9.2001
15 André Lindhorst, in: Kunst und Weltbild, in Ausst.-Kat. (deutsch und englisch) C. R., Galerie am Fischmarkt, Erfurt 1998, S. 20
16 Von Greco bis Goya. Vier Jahrhunderte spanische Malerei, Ausst.-Kat. Haus der Kunst München und Künstlerhaus Wien 1982
17 Detlef Bluemler und Hellmuth Zwecker, in: Deutsche Volkszeitung Nr. 17, 22. April 1982, Kultur, S. 14
18 André Lindhorst, ibd., S. 21
19 Jochen Gerz in einem Gespräch mit dem Autor am 6. Mai 1988 in Düsseldorf
20 Jochen Hörisch, in: Poetisches Neuland. Anmerkungen zu Novalis, in: Novalis, Gedichte. Die Lehrlinge zu Sais, Frankfurt am Main 1987, S. 164
21 Novalis: Die Lehrlinge zu Sais, Die Natur, in: Gedichte, ibd., S. 131f.
22 Rihs-eMail, 27.9.2001
23 Douglas Adams: Per Anhalter durch die Galaxis, München 1979
24 Christoph Rihs, in: Monde, ibd., S. 29
25 Bazon Brock, ibd.
26 Anne Maier, in: Klangschatten. Installationen aktueller Kunst in fünf Erfurter Kirchen, Deutsche Ges. f. christliche Kunst, München 2000, S. 42
27 ibd.
28 Rihs-Email, 27.9.2001
29 Novalis: Die Lehrlinge zu Sais, Die Natur, ibd., S. 131f.
30 Marie-Luise Syring, ibd., S. 11
31 Christoph Rihs in einer eMail vom 26. August 2002 an den Autor
32 Zitiert nach: Hugo Ball (1886 — 1986). Leben und Werk, Pirmasens/München/Zürich 1986, S. 209
33 Rainer Maria Rilke: Der Ball, aus: Die Gedichte, Der neuen Gedichte anderer Teil (1908), Frankfurt am Main 1993, Seite 585f.
34 Rainer Maria Rilke: Über Kunst II, in: Von Kunst-Dingen. Kritische Schriften, Leipzig und Weimar 1981/1990, S. 45
35 Milan Kundera: Die unendliche Leichtigkeit des Seins, München 1984, S. 237
36 Daraus entstand die Wortschöpfung Apollinaires: Surrealisme; siehe: Henry Schumann im Nachwort zu: Charles Baudelaire, Der Künstler und das Moderne Leben, Leipzig 1990, S. 407
37 Charles Baudelaire, Gesammelte Schriften, Werke, Band 4, Leipzig 1981, S. 286
Abbildungen:
Resonanz, 1999
Installation, Aluminium
ø circa 750, Höhe circa 350 cm
ø circa 370, Höhe circa 170 cm
Staatliche Kunsthalle Karslruhe, Forum Rotunde
mondo mio, 1984
Veränderter Globus
Höhe: 25 cm
Privatbesitz
Schilf, 2002
Stipp(angel)ruten, Schellen
Höhe: 400 – 600, Breite: 900, Länge: 900 cm
St. Blaise, Neuenburger See/Schweiz
Photographie: Sandro Vannini, I-Viterbo
Deutsche Scholle, 2002
Sperrholz
Höhe: 80, Breite 470, Länge: 1.100 cm
Installation in der Barfüßer-Kirche in Erfurt
(der «Fisch» wurde unter der Decke installiert)
Künstler — Kritisches Lexikon der Gegenwartskunst, Ausgabe 60. 4. Quartal, Heft 31, München 2002
© Für den Text: Detlef Bluemler und Zeitverlag (ehemals WB-Verlag);
für die Rihs-Abbildungen: © Christoph Rihs
Der Text ist unter dem Titel La raison poétique auch in französischer Sprache erschienen.
Siehe auch: Family Portraits in Multiple Layers: The Korea Times
| Do, 26.11.2009 | link | (11172) | 2 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Bildende Kunst |
La raison poétique
Sur Christoph Rihs
 « Est artiste celui qui revendique de rester visible derrière ce qu’il exprime. Ce n’est pas comme dans le domaine de la science où l’anonymat est sensé s’élever jusqu’à ce que l’énoncé, à force d’anonymat, prenne la forme d’une loi comme tombée droit du ciel. »1 Ce sont les mots de Bazon Brock. Lucius Grisebach est, lui aussi, opposé à « une considération de l’art sans nom » pourtant, li y met des réserves: « il est fréquent que les artistes ne soient pas aimés pour leur art, mais parce que aux yeux du commun des mortels, ils paraissent si bien perdus. »2
« Est artiste celui qui revendique de rester visible derrière ce qu’il exprime. Ce n’est pas comme dans le domaine de la science où l’anonymat est sensé s’élever jusqu’à ce que l’énoncé, à force d’anonymat, prenne la forme d’une loi comme tombée droit du ciel. »1 Ce sont les mots de Bazon Brock. Lucius Grisebach est, lui aussi, opposé à « une considération de l’art sans nom » pourtant, li y met des réserves: « il est fréquent que les artistes ne soient pas aimés pour leur art, mais parce que aux yeux du commun des mortels, ils paraissent si bien perdus. »2« Les Suisses — selon Bertrand Theubet, survivent plutôt qu’ils ne vivent »3 Christoph Rihs est suisse. Bien que né à Bierut — au Liban, il a ‹ survécu › à Bienne où il a passé son bachot, ce qui implique qu’il connaît bien la langue française, et qui se trouve derrière le Fossé ‹ Rösti › qui sépare les mentalités et derrière le (vraiment?) dernier poste de frontière euro-mondial où commence la langue italienne. Là aussi, Christoph Rihs s’est senti comme chez lui, autant dans la langue que dans la mentalité. Entre autre, il a vécu à Rome de 1983 à 1984.
Pendant des années décisives pour lui, il avait son atelier à Düsseldorf – en Rhénanie — où il a poursuivi ses études. En Bourgogne l’attend une ancienne ferme où on croit à chaque instant qu’on va entendre: « silence, on tourne! » et voir arriver les Parisiens en week-end pour une partie de campagne. Mais c’est une camionnette qui débarque ... En descendent: un chien français, une mère américaine et sa fille ‹ mélangée ›, accompagnées du père. On a envie de chanter l’internationale.
La famille Rihs a un appartement ainsi éclairé au cœur de la ville natale du classique allemand: Weimar. Ce n’est pas seulement dans l’aura familière de Goethe que vit cette famille, mais aussi dans la ville initiale de l’université du Bauhaus. Le Bauhaus, l’atelier du Moderne où régnait une raison éclairée, canalisée, calculée au point que le torrent débordant du Romantisme avait encore un pré où s’étaler. Le courrant de Liberté, Égalité, Fraternité coulait vers la diversité, la totalité, l’unité et revenait aux sources. Beuys est sensé avoir dit : « Tout le monde est artiste », ce n’est pas exactement ça; Ce qu’il voulait dire, c’est que chacun est créatif. Beuys connaissait bien le Romantisme. Sa « notion de l’art », si souvent citée, y trouve sa source autant que dans Novalis. Beuys a peut-être subi le même sort que le pauvre Juif de Kurt Tucholsky, qui inventa quelque chose un jour: le calcul différentiel. Mais, lorsqu’il arriva en ville, il s’aperçut que quelqu’un d’autre l’avait trouvé avant lui. Rien n’est jamais nouveau — ou, avec Kurt Tucholsky.4 ‹ Il n’y a pas de nouvelle neige › —
Christoph Rihs, lui aussi, a souvent cru découvrir ce qui existait déjà. Par exemple, en géométrie, cette « partie des mathématiques née de l’étude des propriétés et des formes de l’espace ainsi que de la réalisation de figures bi- et tridimensionnelles, calculs de longueur, largeur, surface et contenu [...] ».5 Il sait ce qui résulte de la rencontre des connaissances. Géométrie? Orientation: « cela signifie: s’y retrouver, faire le bon choix entre de nombreuses possibilités et les rassembler pour obtenir le résultat sur le chemin prometteur de la réussite. L’origine du mot ‹ orientation’ est ‘Orient › (ex oriente lux > qui vient de l’Est, comme la lumière) et se réfère à l’idée que toute culture (comme le soleil?) vient de l’Est (Ainsi, par exemple, l’orientation vers l’Est des églises, des chœurs, des autels) ».6
Les repères d’orientation ont fasciné Christoph Rihs dès l’enfance. Très tôt, il a trouvé que la lecture d’une carte géographique était plus passionnante que de regarder la télévision. Il préférait donc tracer mentalement une ligne sur la carte. Ce qui l’a conduit à la cartographie, à la géométrie; celle-ci étant le modèle de réflexion de l’homme. « Et ce qui est intéressant là-dedans, dit Rihs, c’est que l’homme ne peut pas vivre sans modèle de réflexion »7 Ainsi, sur les sols et murs, il commença par tracer des lignes de couleurs et par fabriquer des objets à partir de bouts de bois. « Dans son installation Rue Dufour (1981), la figure géométrique que l'on reconnaît sur le sol de la maison n'a d'existence que parce qu'une personne a inscrit dans l'espace un certain nombre de mouvements. – fait remarquer Marie-Luise Syring dans son analyse lucide — « Les pas ont été fixés et visualisés sur le sol à la craie, comme ceux d'un danseur de ballet. Pourtant, cette œuvre n'avait rien à voir avec les mouvements abstraits et ritualisés d'un danseur; il ne s'agissait pas non plus d'évaluer, de franchir ou d'appréhender l'espace. Rien n'était cependant laissé au hasard. Rihs a plutôt observé les effets changeants, le champ référentiel de l'influence que peuvent exercer les uns sur les autres l'homme, l'espace et les objets. Il a ainsi esquissé les mouvements qu'une personne avait accomplis dans l'espace délimité par rapport aux objets qui s'y trouvaient. Il n'est plus possible de lire d'après les lignes quelle est la signification des mouvements du promeneur effectuant la visite, que celles-ci aient été suscitées par la répulsion ou par la séduction. Une lecture de nature psychanalitique reste donc exclue. Ce faisant, Christoph Rihs rappelle uns fois de plus à la conscience un fait resté inconscient, tout en appartenant au réel et au vécu, à savoir l'interaction entre homme et objet. Les choses ont, par le biais de nos sens, essentiellement de l’œil, un impact sur l'esprit. En d'autres termes, elles influencent fortement la connaissance et l'attitude de l'individu. »8
Christoph Rihs voulait souligner le processus mécanique du regard « cette image que nous portons nous-mêmes dans le globe oculaire comme quelque chose de matériel que l’on peut projeter vers l’extérieur, un jet de ligne, tantôt fil de laine, tantôt élastique, tantôt trait à la craie sur le sol ». L’existentialiste et phénoménologue Maurice Merlot-Ponty décrit ce phénomène de manière percutante dans L’Œil et l'Esprit (1964) et par-là s'est montré très critique du concept de la raison pure en montrant comment notre comportement réagit sur les choses. » Merleau-Ponty, de concert avec Hedwig Conrad-Martius, Emmanuel Lévinas, Paul Ricœur et Edith Stein considère le corps comme ‹l’Etre au monde ‹ ou pour citer Merleau-Ponty: ‹ la chair du monde ›. « C’est le lieu où se trouvent le langage, la perception, l’action et l’orientation (sic!) »9 « Un corps humain est là quand, entre voyant et visible, [...] entre un œil et un autre, [...] quand s’allume l’étincelle du sentant-sensible, quand prend ce feu qui ne cessera pas de brûler [...] »10
Christoph Rihs place l’observateur, l’homme, au centre de son centre, de son globe, de sa vision du monde. Parfois, comme dans la vraie vie, ce monde est très petit et bizarre (mondo mio, 1984) et puis il change, et son image avec lui. Il en découle différentes perspectives. Des visions du monde apparaissent (1991) parfois, elles sont enterrées (L'enterrement, 1989) ou elles précèdent à des modèles.
Vidéo. Je vois. Sur une bande vidéo pour un projet de l’RWE, des ‹ cathédrales › passent en accéléré: Pyramide, Tadsch Ma Hal, Minaret (ex oriente?), Pise, Tour Eiffel, château d’eau, tour de télévision, réfrigérant atmosphérique ... la représentation du monde de Christoph Rihs sur le réfrigérant atmosphérique — tour 1 de la centrale d’énergie au gaz de Meppen — région d’Ems — a reçu l’adjudication unanime du jury sous la présidence de Ulrich Krempel. Pour Werner Hlubak, membre du comité directeur de direction de l’RWE, la fascination opère surtout quand on pense que le monde a besoin de courant, d’électricité. Christoph Rihs sourit en répondant que [...] « Cette image du monde est assez forte pour susciter bien d’autres associations »11 Et, par exemple! Il y a un monde entre la représentation du monde de Rihs et la peinture minimisante sur la centrale nucléaire de Tricassin sur le Rhône, dans le Sud de la France. Et pas seulement pour la différence entre le gaz et l’atome! « L’un est le produit de l’élan créateur de l’homme, l’autre est la conséquence de ce que l’on a mé-fait. Mon boulot est d’examiner en corrigeant. »
Action réfléchie
« Utiliser mon raisonnement », constate Bazon Brock, « pour éclairer des mécanismes qui me dépassent en pensée et en parole, c’est agir en réfléchissant. Et ça s’est toujours passé comme ça dans le domaine de l’art; pensez, par exemple, à des peintres comme Magritte dont toutes les oeuvres thématiques ne gagnent qu’à travers l’élucidation de ces mécanismes de réflexion. [...] Nous pouvons construire des machines, ce qui signifie faire quelque chose, mais nous ne pouvons pas venir à bout des conséquences de cette action de la même façon que de la construction initiale des machines ou de la production initiale. Ce sont des mécanismes que l’art interroge explicitement depuis 500 ans. C’est pourquoi il existe tout naturellement un rapport étroit entre l’énoncé de problèmes artistiques et esthétiques d’une part, et les débats écologiques d’autre part, pour autant qu’on puisse prendre ces débats au sérieux. » Christoph Rihs ajoute: « Pour chaque travail, tout artiste parcourt à nouveau les étapes de recherche d’expression de forme et de teneur. »12
En parlant du travail de Rihs, André Lindhorst écrit: « Le monde est entièrement contrôlé, fonctionnalisé, démystifié et déromantisé. »13 Déromantisé? Il nous en reste une ruine : la molle écorce de Pandore. Et nos désirs papillotent follement en ricanant autour de nous qui ne nous doutons de rien. Cependant, comment un homme moderne qui voudrait qu’on l’éclaire pourrait-il savoir, lui qui va voir des expositions d’art aussi pour obtenir des informations? Le catalogue sur quatre siècles de peinture espagnole commente une nature morte (Bodégon) comme « un cabinet amusant avec toutes sortes de choses à manger qui poussent sous le climat espagnol. »14 Que les objets représentés sur cette nature morte se réfèrent aux gens de façon symbolique et théologique, qu’ils représentent le monde en images ou l’éphémère des choses terrestres, n’est pas (plus ?) évoqué. Ni un des cinq articles du catalogue, ni une seule légende de tableau ne se réfère à la symbolique religieuse, donc politique, comme: la grenade de l’unité de l’église qui s’ouvre aux croyants ou qui vaut également comme symbole de la résurrection.
« Le monde d’aujourd’hui a fait de la terre l’objet de ses projections globales » — constate André Lindhorst — « et l’art de Chistoph Rihs nous en montre le caractère équivoque .»15 Mais cette phrase de Lindhorst suppose chez Rihs quelque chose que Lindhorst avait enterré une sentence plus tôt: Le Romantisme. L’artiste Jochen Gerz dont on ne peut vraiment pas dire qu’il est le prêtre du sentiment dénoyauté, affirme: « Dans le Romantisme, il y a une panne de la commande, ce qui est en soi un très bel instant, incroyablement affiné et sans la moindre excuse. Tir de précision aussi sur l’art [...] l’art qui ne dure pas, sans public, sans commanditaire. [...] c’est aussi de la politique. Cela correspond à une notion presque française de la politisation. [...]. »16
Le Romantisme est un mot qui vient du mot roman. Vivre le romantisme signifiait: La vie est un roman. Or, le Romantisme veut dire aussi, en parlant ici de Novalis: « Transformer en chaos, déroute, anarchie. Ce sont des notions que les romantiques du début employaient positivement. [...] »17
Ainsi on peut lire: « L’artiste place l’action tout en haut de l’échelle, car son être est d’action et de réalisation à partir de du savoir et de la volonté, et son art est d’utiliser ses outils à toute fin et de représenter le monde à sa façon. C’est pourquoi le principe de son univers est action et son action son art. Ici aussi, la nature devient visible dans une nouvelle splendeur et seul un étourdi rejette avec mépris les mots illisibles et singulièrement confus. »18 Paul Eluard remarquait que le romantique trouvait autant de poésie dans un verre d’eau qu’au fond de la mer.
« Un artiste peut être vénal » — pense Christoph Rihs — « et son produit, matérialisation de sa recherche, peut, bien entendu, être acheté. Mais ça ne signifie pas qu’on achète l’art. Celui-ci croît à la manière d’un chardon qui étend ses racines sous la terre pour poindre là où on s’y attend autant que là où on ne s’y attend pas. »19
Raison et esthétique
La raison n’est pas une chose abstraite que l’on détourne comme le voudrait le tant prisé principe d’utilité. La raison, c’est le Siècle des Lumières, l’époque de l’esprit éclairé. C’est également la lumière du physicien et philosophe Descartes. Mais c’est encore plus sûrement laisser faire: laisser au chardon le loisir de pousser comme la nature le veut. Chez Douglas Adams, l’homme/souris de laboratoire est tenu à une longue laisse dans l’univers.20
Rihs titube en souriant dans l’espace, dans son egoversum, « un mélange de réalité et de tromperie; voilà ma réalité »21 dit-il. « Le titre vole, coccinelle! (Maikäfer flieg!), emprunt d’une chanson pour enfants, de la guerre de trente ans, évoque peut-être ce carnage. Mais il peut tout aussi bien être une toupie ronflante d’enfant, qui dérange la flotte de construction des Vogons d’Adams qui avaient pour mission de faire sauter la terre. Elle chaloupe dans l’espace, défiant les plans d’une voie intergalactique à sens unique.
« Je trouve cette formule bizarre, qu’un artiste dise ce qu’il recherche. Moi, je ne peux pas. Il y a des choses très définies qui reviennent dans mon travail de façon répétitive, mais je suis incapable de formuler ce que c’est. » Il en est de même pour le choix préalable des matériaux pour ce qu’il veut faire. « Je ne choisis pas un matériau parce qu’il me fait plaisir, je m’en sers intuitivement et c’est plus tard que je me pose des questions sur la technique. »
Nous sommes sur la rive du lac suisse de Neuchâtel et nous sommes charmés par les roseaux qui apparaissent à travers les brumes matinales. De la même façon, à travers notre savoir, l’âme des 18 et 19ème siècles s’infiltre et nous fait vibrer de ravissement, d’absence à nous-mêmes. Et aujourd’hui, justement, à l’époque technoïde, nous rêvons de nature, des jours qui nous enlèvent à la conscience de la détruire. Calme, silence. C’est presque aussi beau que si c’était peint par Caspar David Friedrich. Et voilà que l’embarquement pour Cythère de 1717, du préromantique Antoine Watteau nous emporte vers la volupté. Accadie. Le soleil perce le brouillard, le dissipe. Notre tête se libère du coton qui l’obstruait, se dépouille. Des bruits. Une sonnerie : celle de la terrible réalité? Certes: c’était un mirage. L’image du monde que nous voudrions voir redevient rude réalité. Et les roseaux ne sont que des lignes de pêcheurs. Il y pend des grelots comme on en entend (aussi) au carnaval allemanique chez les racoleurs de snack-bars de poisson; ce qui montre que nous pendons au crochet.
Ils nous tintent aux oreilles, ces rires homériques retentissants qui n’en finissent pas, sortis de l’Iliade et de l’Odyssée de Christoph Rihs: roseaux (Schilf). « Je ne peux pas dire avec précision pourquoi je peins. J’essaie de résoudre des problèmes. » Christoph Rihs résout notre problème esthétique. Cependant, l’esthétique ne signifie plus ‘la science du beau’, la beauté d’Apollon, sans profondeur, l’idéal classique prôné par son défenseur Johann Joachim Winckelmann. L’esthétique signifie, depuis l’Aestetica des années 1750/1758 de Alexander Gottlieb Baumgarten, expression de différentes façons de voir. Ce qui veut dire, selon Bazon Brock: « Nous n’avons plus besoin de réponse à la question, ce qui est intéressant, c’est la question en soi, à savoir: Comment se fait-il qu’il y ait des appréciations différentes face aux mêmes objets considérés et aux capacités de jugement assez proches de personnes dotées des mêmes moyens d’appréciation? Et surtout, que signifient ces appréciations différentes? »22
Connaissance et savoir
Voilà comment un bateau peut devenir poisson puis de nouveau un bateau ou une autre découverte. (Bateau, 2000). À Erfurt, il y avait des œuvres représentant ces êtres hybrides, résultat d’un accouchement d’images à la Rihs. Celui-ci y voit moins une métaphore qu’un jeu de mots (en allemand : Fisch/Schiff), « comme un produit technique qui aurait finalement, en qualité de poisson, la faculté de se mouvoir dans un médium qui n’est pas le nôtre. » Le médium, c’était la cathédrale de Erfurt: « Point sensible et visible à la limite du Roman tardif et du Gothique » — écrit Anne Maier — « où Christoph Rihs a su ancrer son aéronef. L’abside avec ses deux dépendances date du Roman tardif et sert de transition entre la croisée plus ancienne et le chœur très surélevé du gothique avancé. L’importance de ce lien entre le bâtiment ancien et le plus jeune, l’église ancienne et la nouvelle, est soulignée par cette intervention artistique. [...] Ici, Christoph Rihs [...] veut aller plus loin que de provoquer la sensation de voler. Il intervient dans le processus de désincarnation et de spiritualisation de cette construction gothique hiératique: son squelette en acier inoxydable renforcé de couples en aluminium, entouré de part en part, de la proue à la poupe, par un câble en acier de 3 mm de diamètre fait figure de commentaire matérialisé de l’harmonie divine. Bernard de Clairvaux a établi les principes spirituels de la science des cathédrales gothiques. Ainsi, le transept est-il défini comme le lien entre le style Roman dit non-spirituel, magnifique et bien assis, et le gothique pénétré de spiritualité, défiant toute notion de pesanteur. Rihs se préoccupe depuis longtemps de visualiser par son art l’idée de se détacher de la terre par l’esprit. »23 Contrairement à l’évocation de ses visions du monde, il ne s’agit pas ici, pour lui, de l’artiste et de sa réalisation, ni même du rêve de voler. Il s’agit de la connaissance, donc d’abord de la cognition. Le mot grec pour poisson est ICHTHYS. Il servait de code pour les premiers chrétiens afin de se reconnaître les uns les autres. Or, il découle une formule de cette notion: ‹ Jésus Christ, fils de Dieu, Sauveur › qui entraîne une réflexion donnant lieu à différentes interprétations. Pour Anne Maier, la définition se présente comme telle: » Poisson ou bateau, Christoph Rihs ne tranche pas, l’un comme l’autre lâche la bride à l’imagination artistique et à la richesse des pensées religieuses. Il confirme l’expérience religieuse de Martin Buber d’un Autre qui ne peut s’inscrire dans le contexte de la vie. La religiosité transfère. Là, il y avait l’existence habituelle avec ses affaires, ici régnait le ravissement, l’illumination, l’enchantement, hors du temps, sans suite. L’existence en soi englobait l’ici-bas et l’au-delà, et il n’y avait d’autre lien que chaque moment précis du transfert. [...] Si c’est ça la religion, alors elle est tout, la simple totalité vécue dans sa possibilité de discorde. »24
« Est-ce qu’une coopération peut s’établir, par comparaison, entre l’art et la religion, voire l’Eglise, sur la base d’orientations parallèles? Se demande Christoph Rihs. Les valeurs de l’art sont (actuellement) établies par les artistes (et, par la suite, leurs interprètes) et elles se renouvellent tout le temps. Au contraire, les églises proposent leurs orientations par les Ecritures fixées, déterminantes ‹ (Veda, Pali, Bible, Tanach, Coran, etc.) La foi pour la connaissance? L’un reflète un monde (moderne) où chacun peut — et doit — trouver lui-même ses propres valeurs; l’autre reflète l’Histoire des hommes (et ses traditions), l’autorité souveraine étant parfois entre les mêmes mains que l’aide proposée. Il me semble qu’il y a là un mur très élevé qui empêche un travail d’épaule à épaule quand on considère la façon de travailler de nos artistes contemporains »25 En l’occurrence, nous avions l’exemple d’une église, et même d’une cathédrale, qui mène loin dans un univers attribué à un seigneur auquel on a consacré toute une religion. Anne Maier ne se trompe donc pas. Seulement, sa projection dans l’infini est tout autre. Rihs se saisit volontiers de cet autre infini, mais prend-il les choses au sérieux ? C’est plutôt avec ironie qu’il salue d’un Hello Halley la plus claire des comètes qui nous a éclairés la dernière fois en 1986 et qui a illuminé les journaux et la télévision — et nous par là-même. Et autant Hello Halley de Rihs nous rappelle un atelier de bricolage, autant vole, coccinelle!, évoque Giotto, la sonde spatiale blessée qui fut envoyée dans l’espace dans le seul but d’observer (Hello) Halley. Novalis explique cette démarche comme suit: « Quand le penseur [...] en tant qu’artiste s’engage, à raison, sur le chemin de l’action et cherche à réduire l’espace à une simple et mystérieuse figure par une application adroite de son mouvement intellectuel ... »26
Le ballon terrestre
Christoph Rihs est un produit multiplexe. Ici encore, c’est en souriant qu’il appellerait son osservatorio romano (1985) un jeu de mot. L’ osservatorio romano du Saint-Siège est l’observateur journalistique et spirituel du monde temporel. L’osservatorio romano est aussi la station d’observation spatiale du poète élucidant, Christoph Rihs. Établissant un parallèle avec Salle de vision (Seh-Raum) de 1993, également intitulé Egoversum, Marie-Luise Syring gratte de son tuyau de plume la plaie qui se met à saigner : « Une dissertation de ce type sur le processus le la perception visuelle et des illusions d'optique, ou plutôt des lois de l'optique est chargée de plus de signification qu'une simple traduction de la connaissance de la Nature dans un langage de la fiction. Cette œuvre, pour ainsi dire, nous donne les instruments de l'introspection tout en devenant le symbole d'une Welt-Anschauung tournée à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur. Et conservant toute son ambiguïté.»27
L’egoversum de Rihs retrouve l’univers de Johannes Brahms. À Meiningen, en Thuringe, donc à peu de distance du toit qui abrite les archives de Goethe et de Schiller ensemble (On ne souffre la vérité qu’en rusant) il fut donné à Brahms, grâce à l’intervention de son ami le chef d’orchestre Hans von Bülow, de s’introduire dans la petite principauté locale et de jouer dans son orchestre. Christoph Rihs a fait la même chose à Meiningen par le biais de Bols (1999). Là aussi, il a visé haut. Le modèle de ce modèle est ‹ La pomme terrestre ›, le premier globe terrestre produit par le cosmographe Martin Behaim en 1492. « Bols sont des représentations dissolues du monde comprenant un regard sur la nature comme vue d’une cage. Si, du globe terrestre, il ne reste que la géométrie, cela représente pour moi la réduction du concept de Weltanschauung à l’origine et au pivot de tout modèle de réflexion. »28
Les moins jeunes connaissent ‹ Bols ›. ‹ Bols-Bleu ›, l’Apéritif, qui provoqua un bizarre bourdonnement dans la tête. Un peu comme en estropiant le mot balle : le bal de Brahms. Le dadaïste Hugo Ball pourrait aussi se prêter à ce jeu. Dans la préface au livre de H. Ball la chrétienté byzantine Waldemar Gurian s’est référé à ce que, dans le monde moderne occidental, la « considération symbolique » de l’Histoire est presque entièrement oubliée.29 Un rapprochement symbolique est facile en français entre le globe et le ballon, ce qui nous conduit au poème volant et sautant de Rainer Maria Rilke:
« Balle ronde qui propages dans ton vol
la chaleur de deux mains, insouciante
comme tes possessions; ce qui ne peut rester
dans les objets, ce qui pour eux est trop léger,
trop peu chose et pourtant assez chose
pour ne pas, de tout ce qui dehors s´aligne,
invisible soudain glisser en nous:
cela glisse en toi, entre vol et chute,
indécise encore: qui alors que tu montes,
ravis et libères le jet, comme si
tu l´avais emporté, - puis tu t´inclines
et suspends ta course, et de là-haut soudain
montres aux joueurs un nouveau lieu,
comme les ordonnant en figure de danse
pour alors, attendue, souhaitée de tous,
rapide, simple, pure, toute nature,
retomber dans la coupe des hautes mains tendues. »30
Rainer Maria Rilke parle du « continuel gaspillage de toute valeur variable »31 et puis: de ne jamais s’arrêter de s’ébattre dans l’éternelle curiosité de savoir.
S’il y a une spécificité suisse dont découle un humour spécifiquement suisse, c’est, d’abord, le besoin irrépressible d’ordre. En cela et avec cela, on aime masquer. Milan Kundera n’a certainement pas visé la Suisse mais il a conclu immuablement: « que l’idéal esthétique de la bonne entente catégorique avec l’existence est un monde où la merde est niée et où tout le monde fait comme si elle n’existait pas. Cet idéal esthétique s’appelle Kitsch. »32
« La modernité — écrivait en 1863, le sur-naturaliste Charles Baudelaire33 — est ce qui passe, ce qui disparaît, ce qui est fortuit.34 Ou encore: « le beau est toujours bizarre. »35
L’auteur est coéditeur du Encyclopédie Critique d'Art Contemporain (Kritisches Lexikon der Gegenwartskunst). Il est aussi publiciste dans le domaine de l’art et de la culture (aica). Il travaille à Hambourg et vit à Marseille.
Notes
1 Bazon Brock, dans : Interview avec l’auteur au sujet de l’écologie et de l’esthétique, pour la radio Westdeutscher Rundfunk, Cologne 1982
2 Lucius Grisebach : Le peintre Werner Heldt : W. H., ed. Lucius Grisebach, cat. Kunsthalle Nürnberg , Nuremberg 1990, p. 66
3 Bertrand Theubet : Abîmes suisses, Documentation, arte, 21.08.02, 20.45 h
4 Kurt Tucholsky : Es gibt keinen Neuschnee, Gesammelte Werke 1925 – 1926, Reinbek 1811993, Bd. 9, p. 74f.
5 Brockhaus PC-Bibliotheque 3.0, 2001
6 Rihs dans un courrier électronique à l’auteur, le 27 septembre 2001
7 Christoph Rihs dans un entretien avec l’auteur à Bourguignon (Bourgogne) le 15 mai 2001 ; sauf annotation spécifiée, toutes les citations se rapportent à cet entretien
8 Marie-Luise Syring : Une anatomie de la perception visuelle, dans : Monde, cat. D’exposition. (all. / fr.) Faux-Mouvement, La Cour d'Or, Musées de Metz, 1989, p. 8ff.
9 Marit Rullmann et Werner Schlegel : philosophie du corps plus que de la raison, Frankfort / Main 2000, p. 101
10 Maurice Merleau-Ponty: L'Œil et l'Esprit, Paris 1964, p. 21
11 Bande vidéo de l’RWE, 1994
12 Rihs, courrier électronique à l’auteur, le 27 sept. 2001
13 André Lindhorst, dans: Kunst und Weltbild, in cat. d’exposition. (all. /angl.) C. R., Galerie am Fischmarkt, Erfurt 1998, p. 20
14 Von Greco bis Goya. Quatre siècles d’art espagnol, cat. d’exposition. Haus der Kunst München et Künstlerhaus Wien 1982
15 André Lindhorst, ibd., p. 20
16 Jochen Gerz dans un entretien avec l’auteur le 6 mai 1988
17 Jochen Hörisch, dans : Poetisches Neuland. Remarques sur Novalis. Novalis, poèmes. Die Lehrlinge zu Sais. Francfort / Main 1987, p. 164
18 Novalis: Die Lehrlinge zu Sais, Die Natur. Gedichte, ibd., p. 131f.
19 Rihs, courrier électronique à l’auteur, 27 septembre 2001
20 Douglas Adams : En stop dans la Galaxis, Munich 1979
21 Christoph Rihs : Monde, ibd., p. 29
22 Bazon Brock, ibd.
23 Anne Maier: Ombres de sons. Installations d’art actuel dans cinq églises de Erfurt, Munich 2000, p. 42
24 ibd.
25 Rihs, courrier électronique à l’auteur, le 27 septembre 2001
26 Novalis: Die Lehrlinge zu Sais. Die Natur, ibd., p. 131f.
27 Marie-Luise Syring, ibd., p. 11
28 Rihs dans un courrier électronique à l’auteur, le 26 août 2002
29 D’après: Hugo Ball (1886 – 1986). Vie et œuvre, Pirmasens/Munich/Zurich 1986, p. 209
30 Rainer Maria Rilke : La balle, tiré de: Œuvres complètes. Poésie. Nouveaux poèmes, deuxième partie, Paris 1972, p. 295
31 Rainer Maria Rilke: Über Kunst II. Von Kunst-Dingen. Kritische Schriften, Leipzig et Weimar 1981/1990, p. 45
32 Milan Kundera: L’insoutenable légèreté de l’être, en allemand : Munich 1984, p. 237
33 D’où le néologisme d’Apollinaire: Surréalisme; voir: cité d’après de Henry Schumann : Charles Baudelaire, Der Künstler und das Moderne Leben (L’artiste et la Vie Moderne), Leipzig 1990, p. 407
34 Charles Baudelaire, Gesammelte Schriften. Werke (Œuvre), Bd 4, en allemand : Leipzig 1981, p. 286
35 cité d’après: Henry Schumann, ibd., p. 408
Deutsche Fassung
© dbm, Kritisches Lexikon der Gegenwartskunst
Veuillez respecter ce qui suit:
Family Portraits in Multiple Layers: The Korea Times
| Di, 24.11.2009 | link | (4937) | 1 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Bildende Kunst |
Poesie liebt Mimikry
Die Blüten des Schönen
Über Johannes Muggenthaler
 Viel fehlte nicht, und der Autor folgender Nach-Denkung fiele wegen seiner Neigung aus dem Fenster zum Weitblick: Hans Blumenbergs poetische Philosophie-Denkzettel von der Verführbarkeit des Philosophen zum Cicerone der Muggenthalerschen Kunst-Poesie-Kunst zu erklären. «Was [...] Meister herausfordert, logische Verborgenheit in optische Präsenz zu steigern. Anders ausgedrückt: Das für eine Geschichte Bedeutungslose erhält die Auszeichnung optischer Bedeutsamkeit.»1 Wären da als Handbücher nicht auch Muggenthalers eigene Schriften, er stürzte — den Leser ins Mikrokosmische. Gleichwohl: seit es Computer gibt, wissen wir, wie weit die Welt wird; und die Wissenschaft lehrt uns, daß in jedem noch so winzigen Etwas das Unendliche enthalten ist.
Viel fehlte nicht, und der Autor folgender Nach-Denkung fiele wegen seiner Neigung aus dem Fenster zum Weitblick: Hans Blumenbergs poetische Philosophie-Denkzettel von der Verführbarkeit des Philosophen zum Cicerone der Muggenthalerschen Kunst-Poesie-Kunst zu erklären. «Was [...] Meister herausfordert, logische Verborgenheit in optische Präsenz zu steigern. Anders ausgedrückt: Das für eine Geschichte Bedeutungslose erhält die Auszeichnung optischer Bedeutsamkeit.»1 Wären da als Handbücher nicht auch Muggenthalers eigene Schriften, er stürzte — den Leser ins Mikrokosmische. Gleichwohl: seit es Computer gibt, wissen wir, wie weit die Welt wird; und die Wissenschaft lehrt uns, daß in jedem noch so winzigen Etwas das Unendliche enthalten ist.Zwar liegen da Worte vor, die hermetisch wirken. Doch das Kryptische wirkt bei Muggenthalers Kunst-Poesie zigtausende Hertz-Takte entfernt von der banalen Unverständlichkeit neumedialer Nutz-Leid-Faden. Aber fordert er nicht etwa schreibend wie bildend eine Rück-, sozusagen eine ‹Heim›-Kehr in eine (Bild-)Sprache ein, die in einem quasi-theologischen2 Ursprung romantisch gegen die Aufklärung zielt?3 Auch könnte der Verdacht naheliegen, er ebnete einer fehlgeleiteten Erinnerung einen Pfad nach Arkadien — würde nicht der Blick zwischen die (Bild-)Zeilen auf-klaren, wie abgefeimt diese Anrufung des Paradieses ist. So bildet sich hier schon eher ein Novalis des Auges seine Fluchten von Neuropa nach Eumeswil.4
«In kantig aneinander gesetzten Bildern und kraftvoll gefugter Handlung macht Muggenthaler den Reichtum im Widerspiel von Kultur und Natur sichtbar: Schicht um Schicht überlagern sich Macht des Wetters und Sturm des Gefühls, Labyrinth des Waldes und Irrgarten der Stadt, Tempel und Kerker, Paradies und Welt, Kunst des Erzählens und blütenreiches Wachstum der Fantasie — [...] eine doppelbödige Magie, in deren Bann der Leser selbst sich in der schimmernden Bedeutungsvielfalt der Texte glücklich verirrt.»5
Wie man sich glücklich verirrt, lautet der Titel dieser gebundenen Poesie; Normal und sterblich, Liebe und Schulden hießen ihre Vorgängerinnen. Der Liebe Pilgerfahrt ward Muggenthalers Ausstellung 1992 im Münchner Stadtmuseum von ihm geheißen. Doch wäre die Liebe und deren Pilgerfahrt allein nicht schon genug, der Oberammergauer (* 1955) mit der Physiognomie eines toskanischen Landmannes und der Aussprache des Wurzellosen setzt noch einen drunter: Photographische Schautafeln zur Seelenforschung.
Wie's da drinnen aussieht in der psychischen (physischen?) Beschaffenheit des Trinkenden Kosmonauten (1992) mag vordergründig die Wodka-Flasche mit dem ihr beigestellten Glas belegen, und auch die geröteten Augen könnten Zeugnis andeuten, Tränen der Trauer geflossen sein, Psyche ihn gemartert haben. Oder aber doch eher der Muggenthalersche Blick auf die Konstante des Ereignislosen: «Mächtig steht die Frage auf, wie dem Tag in die Knie zu verhelfen ist. Früher war das anders, da waren die Tage nicht so lang. Ungefragt vergingen sie wieder. Was bietet das Leben an Spannung, nicht viel. Die Dramaturgie ist schlecht, und wo man hinsieht Längen, fürchterliche Längen!»6 Frage? Antwort? Ach Einstein. Nehmen wir doch einfach dein E=mc2 in den schlichten (Volks-)Mund — alles ist relativ.
Wo die einen den (runden) Kopf benutzen, um Gedanken ohne jede Pause klingelnd und klimpernd die Richtung ändern zu lassen, flaniert7 Muggenthaler kreisend in ihm und löckt wider den Stachel8 von Ariadnes Flucht-Tragödie. So bestätigt der Künstler (Muggenthaler) sich und den Philosophen (Blumenberg), der meint, «Leitfäden, deren Enden niemand gesichert hat, haben etwas Artistisches». Aber Muggenthaler bedeutet seinen «Gängern im Ungewissen»9, daß sie nicht fürchten müssen, sich zu verlieren, denn schließlich wisse er, der Künstler, doch, in wessen Händen Ariadnes Blaues Band liege. Verwirrend sicher also legt Muggenthaler die Anfänge seiner Fäden (überall hin), und in verblüffender Logik schweben die Enden immer zu ihren vagen Auflegepunkten (und des Philosophen Mahnung) zurück. — Ob es mit dem Wort beginnt und mit dem Bild endet und umgekehrt bzw. beide ein voneinander unabhängiges Da-Sein führen, immer entsteht ein Bild aus Wörtern, fügen sich Wörter zu Worten zu einem Bild zusammen — und geraten so zu jener Consommée, in der reine Vielfalt köchelt. Der neumediale Fast-food-Koch nennt diese Kunst-Ur-Suppe «Crossover».
Der Poesie — ob der sprachlichen oder bildnerischen — inne wohnt die Sehnsucht: nach einer Abkehr — vom schieren Verstand. Doch wider den falsch verstandenen Part, den die Romantik im Streben des jeansuniformierten Individuums nach nostalgischer Absonderung verordnet bekam, läßt die Bild-Sprache Muggenthalers im Gefolge von Jean Paul oder E. T. A. Hoffmann oder, wenn auch weniger schmerzhaft, Jochen Gerz in sich sezierend die Saiten schwingen: Das Sehnen nach diesem anderen Zustand wird überdehnt — bis zum fröhlich-befreienden Bersten. Denn nicht dorthin, wo die Esoterik als das Wissen Eingeweihter um die Geheimnisse entkernt und mit verquaster Tümelei, der Billigdroge Sinnentleertheit aufgefüllt wurde, will der Stein. Der will zurück zur Schleuder.10
Nach Kythera in Adriapolis
Ich führe gern in ein Land, wo es mich noch nicht gibt. Des sehr frühen Romantikers11 Antoine Watteau Einschiffung nach Kythera von 1717 macht die Landschaft weit, und dessen Nachfahrer Muggenthaler setzt sein Schiff dazu — als Wehmut-Spritzer auf die Breitwand der Sehnsuchtsindustrie. In vertrackter grammatikalischer Korrektheit assoziiert er es mit einem quasi-poetischen Hymnus an die Ferne. Beide sind bekannte Bilder. Beide haben sie ihre ureigene Gültigkeit, sowohl in ihren originären Bedeutungen als auch in der jeweiligen Okkupation durch die Fremdenverkehrswirtschaft. Das an maritimem Gestade gemach aufs Wasser wartende Schiff, das von der See hinausgeführt werden will ins Endlose. Das unter südlicher Sonne geduldig seines Passagiers harrende Schiff, das ihn hinausführen soll aus seiner ballermannischen oder seiner hochkulturüberheizten Tristesse hinaus in die klimafreie Zone. Gelagert ist dieses Denk-Mal auf dem Sand einer Fernsucht, in den Myriaden von Träumereien Eier legen; wie weit solche Gedanken fliegen und wie wahr sie in der Wirklichkeit dieses Begehrens sind, weiß man aus der Zeit, als man solches noch gelesen oder davon gehört hatte. Fixiert ist das scheinbar seefahrtsbereite Rückbesinnungs-Teil also auf einem Glauben, der von der Aphorismus-Vermarktung in den Rudimentär-Ganglien verankert worden ist. Lediglich das Schemenhafte dieses ungewohnt korrekten Konjunktivs — mit ihm gerät die Sicherheit dann doch ein wenig aus dem Lot der ansonsten wohl berechtigten Vermutung, es könnte sich dabei um Sprache handeln. Beide, Bild und Wort, fahren also (gemeinsam) los, wenn sie denn losfahren. Am Ziel, endlich: der Rezipient. Als Hase.
Denn dort steht bereits Johannes Muggenthaler, das von Freundin Ariadne geborgte und flatternd fliehende Zielband in der Hand. Beschriftet hat er es einmal mehr in seiner eigen-artigen Dicht(er)-Sprache: «Du grüßt jeden, aber du kennst keinen», ‹veredelt› noch im Titel Sich suchen, nichts finden ... (2000; oben). Er zeigt die Hoffnung im überreifen neunten Monat — einer Scheinschwangerschaft: Du wirst immer mehr ... (1984). Als böte Der Austausch von Geschenken zwischen Mensch und Tier (1989) ein Loch, in der die brennende Sehnsucht Kühlung fände. Auch eine Taube ist ja nur ein Mensch. Auch sie will anders(wo) sein. Aber ach: Selbst der Um-Weg als Ziel bietet keine Heimstatt des Seins.
Muggenthaler ist ein zauberhafter Lügner, der sich Wahrheiten aus dem Mythenfundus der Antike geborgt und zu seinen verwandelt hat. Von solcher Bande lernt man Wunder. Theseus lieh ihm das Garnknäuel, gleichwohl Ariadne einen anderen (immerhin Dionysos) nahm; doch wie sehr er, der Künstler, sie nach wie vor lieben muß, belegen zahlreiche photographische Portraits von eindringlicher Anmut (die ja bekanntlich außen als Schönheit aufblüht). Die Töne in die Lage der Königin der Nacht zu ziehen, das haben ihm Odysseus' Lock-Vögel beigebracht. Aus diesem Akt hat der Dramatiker auch gelernt, die Sinnesorgane so zu wachsen, daß sogar Alarmanlagen keine Töne mehr haben. Ihm selbst kann nichts geschehen, hat er sich doch am Mast der Kunst selbst fest verzurrt. Und die Mimikry, die hat er von denen, die uns die lingua franca (auch die des feinziselierten Humors) gespendet haben. Wie diese Orchidee, die als Wespe die Wespe betört, bedient er sich der Lust als sinnvoller Täuschung. Und die dient schließlich (auch) der Vermehrung — seiner Zwitterwesen, die selbst nie die Erkenntnis preisgäben, sie gehörten einer Gattung an: Bild oder Wort. Jeweils ein Eigenleben führen sie, wie das Weibliche beziehungsweise Männliche im jeweiligen Geschlecht, das bereits in sich selbst sich verirrt. So sind sie immer jene (nicht-moderne) Poesie, wie sie nur der Romantiker hervorbringt, der nach ihr nicht fragt, dessen Hoffnung(slosigkeit) sich trägt in seinem Wehmutslied durchs optisch heruntergekommene Adriapolis (Serie, 1998), das auch Jesolo oder Rimini heißt und in dem es dem Tenor der Schönheit die Sinne umschlägt: «Weil man sich öde geworden ist am alten Ort, weil man das Bekannte kennt bis zur Unkenntlichkeit, bis zur Gewohnheit. Hier aber, alarmiert von den Gefahren und Lockungen der Fremde, erwacht das Selbst und fühlt sich besonders.»12 Und so singt der Künstler dann die Mimikry des eig'nen Sinns.
In einer seiner beiden komischen Tragödien Normal und sterblich ist es vermutlich Muggenthaler, der sich Nietsche heißt. Diesen seinen Genius läßt er flehen, es müsse «doch eine Grenze sein zwischen Sein und Nichtsein». Doch da das Sein am Firmament den Kopf sich stößt, läßt der romantische Poet die Suche sein.
Anmerkungen
1 Blumenberg, Hans: Ein MacGuffin, in: Die Verführbarkeit des Philosophen, Frankfurt am Main 2000, S. 96
2 Dazu Blumenberg: «Der ‹große Theologe› zeichnet sich aus nicht durch die Fragen, die er stellt, vielmehr durch die, die er verhindert. [...] Beantwortung und Verhinderung der Frage müssen ineins gehen, verwechselbar werden.» In: Vorsicht im Umgang mit Engeln, a. a. O., S. 115
3 Romantik: «1694 erstmals in Frankreich, 1698 erstmals in Dtl. belegt, bezeichnete [zunächst] die Pathoswirkungen einer wilden Landschaft, bis [sie] schliesslich Jean-Jacques Rousseau zum Ausdruck der Einheit von landschaftl. und seel. Qualitäten diente und die Begründer der romant. Bewegung es zur Bez. des höchsten Kunstprinzips erklärten [...].» (Brockhaus-PC-Bibliothek); weltanschauliche Bewegung gegen den Rationalismus
4 Roman von Ernst Jünger, in dem sich der ‹Anarch‹ aus der ungeliebten Gesellschaft gräbt; Stuttgart 1980
5 Landfester, Ulrike: J. M., Wie man sich glücklich verirrt. Waldgeschichten, Laubacher Feuilleton Nr. 15, München 1995, S. 12
6 Muggenthaler, Johannes, Normal und sterblich. Zwei komische Tragödien, Hamburg 1984, S. 19
7 «Flanieren ist [eben] keine Beschäftigung für Freizeit-Konsumenten», meint Claus Koch; Süddeutsche Zeitung v. 2. März 2001, S. 16
8 Wider den Stachel löcken: eine Sache be-, antreiben (früher: den Ochsen); Kluge, Etymologisches Wörterbuch, Berlin/New York 1999 (23. Aufl.), S. 509
9 Blumenberg, Hans: Der Holzweg zu den Quellen, a. a. O., S. 86
10 Der Stein will zurück zur Schleuder: Titel einer Arbeit von Jochen Gerz, von dem auch die Äußerung stammt: «In der Natur sehne ich mich nicht nach der Natur.»
11 Wobei hier nicht die historische Epoche (s. Anm. 3) gemeint ist, die den Menschen nicht erhöht, sondern in der Natur verkleinert; wie das in vielen Gemälden von Caspar David Friedrich deutlich wird. Hier zielt es auf denjenigen ab, der meint, die Natur käme seinen Sehnsüchten entgegen, habe ihr entgegenzukommen, ggf. im französischen Sinn von Civilisation, der im Deutschen Kultur genannt wird; der Begriff Romantik wird heute auch weitgehend (wieder?) so gewertet, zumindest umgangssprachlich bzw. in breiteren Bevölkerungsschichten. Siehe auch Anm. 10.
12 Muggenthaler, Johannes, in: Informationsblatt zur Ausstellung in der Galerie Mosel & Tschechow, München, Dezember 2000 — Januar 2001
Der Autor ist Gründungsherausgeber von Künstler — Kritisches Lexikon der Gegenwartskunst (seit 1988), betreute bis 2006 verantwortlich dessen Redaktion und ist nun als Kunst- sowie Kulturpublizist tätig (Mitglied von aica, Internationaler Kunstkritikerverband). Er lebt in Hamburg und im südfranzösischen l'Estaque.
Künstler — Kritisches Lexikon der Gegenwartskunst, Ausgabe 54, München 2001
© Für den Text: Detlef Bluemler und Zeitverlag (ehemals WB-Verlag);
für die Muggenthaler-Abbildungen: © Johannes Muggenthaler
Der Text ist unter dem Titel La poésie aime le mimétisme — Les fleurs du Beau auch in französischer Sprache erschienen.
Siehe auch:
Mosel und Tschechow
Magie oder Maggi
Normal und sterblich
Liebe und Schulden
Wie man sich glücklich verirrt
Regen und andere Niederschläge
Der Idiotenhügel
| Di, 17.11.2009 | link | (5119) | 0 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Bildende Kunst |
la chose ist das hierher umziehende Archiv von micmac.
Letzte Aktualisierung: 30.10.2015, 04:39
Zum Kommentieren bitte anmelden.
? Aktuelle Seite
? Themen
? Impressum
? Blogger.de
? Spenden
Letzte Kommentare:
/
«Das Sprechen
(micmac)
/
Christoph Rihs:
(micmac)
/
Rihs
(micmac)
/
Frühe Köpfe
(micmac)
/
Rihs' Wort-Spiel
(micmac)
/
Für eine Sprache
(micmac)
/
Ein Bild machen
(micmac)
Suche:
Alle Rechte liegen bei © micmac.
? Aktuelle Seite
? Themen
? Impressum
? Blogger.de
? Spenden
Letzte Kommentare:
/
«Das Sprechen
(micmac)
/
Christoph Rihs:
(micmac)
/
Rihs
(micmac)
/
Frühe Köpfe
(micmac)
/
Rihs' Wort-Spiel
(micmac)
/
Für eine Sprache
(micmac)
/
Ein Bild machen
(micmac)
März 2026 |
||||||
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
1 |
||||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|||||
Suche:
Alle Rechte liegen bei © micmac.